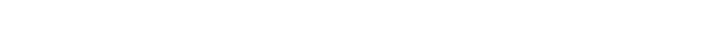von Fritz Lang (Regie) mit
Peter Lorre in der Hauptrolle
ist ein früher deutscher
Tonfilm, 1931 produziert von
der Nero-Film AG in Berlin.
»Langs erster Tonfilm gehört
zu den Meisterwerken des
deutschen Vorkriegskinos.
Verweise auf das gesell-
schaftliche Klima der
Weimarer Republik am
Vorabend des
Nationalsozialismus sind
augenfällig: Obrigkeit und
Unterwelt erscheinen als
gleichartige
Organisationen, die den
>Abartigen< im Namen
des >gesunden
Volksempfindens< gemeinsam zur Strecke
bringen. Langs sarkastische Schilderungen von Menschenjagd und
Massenhysterie sowie Peter Lorres geniale Interpretation des Mörders als Täter und Opfer zu-
gleich wurden von den Nationalsozialisten später nicht ohne Grund als subversiv empfun-
den.« (Lexikon des Internationalen Films, 2018)
Zusammen mit der Prometheus-Film-Gesellschaft, die der KPD nahestand und als >proletarisch<
galt, bildete die NERO am Ende der Weimarer Republik eine letzte Bastion gegen den schon längst
offen auftretenden Nazi-Terror. Während Prometheus vorwiegend die Filmklassiker der Sowjetunion
in Deutschland vertrat und als letzten Film »Kuhle Wampe« von Brecht-Dudow-Eisler produzierte,
übernahm die NERO die gesellschaftskritische Tradition des bürgerlichen Films, die sich vor allem
mit dem Namen Richard Oswald verband.
Das Label NERO, gebildet aus den Anfangsbuchstaben der Produktionschefs Seymour Nebenzahl
und Richard Oswald, wurde 1925 gegründet. Zur Zeit des
Dreigroschenprozesses (1930/31) hatte sich die NERO als füh-
rende Produktionsstätte avantgardistischer Filmkunst in Europa
etabliert und war auf dem Weg, sich Weltgeltung zu verschaffen.
Den Dreigroschenfilm von G.W. Pabst (1931) ließ Nebenzahl
gleichzeitig in französischer Version drehen, und Warner Brothers
(USA) gehörte bereits zu den Finanziers.
Es brauchte nicht erst der legalen Machtübergabe an die Nazis
durch das bürgerlich-demokratische Parlament der Weimarer
Republik (ohne
die Stimmen der
SPD und der
KPD), um die
fortschrittliche
Filmbranche in
Deutschland zu
zerschlagen und
ihre Ästhetik, damals noch >Lichtspiel< genannt, zu
liquidieren. Die Nazi-Propaganda setzte an dessen
Stelle, unter hemmungsloser Ausnutzung der techni-
schen Möglichkeiten, Lichtspiele glänzender
Illuminationen, verbunden mit den offenen
Lauffeuern mythisch-mystischer
Masseninszenierungen, zelebriert und gefürchtet in
der großstädtischen Öffentlichkeit, sobald der Abend
dämmerte und die Nacht einbrach.
Die Nero-Film AG musste ihre Arbeit einstellen.
Seymour Nebenzahl wurde, um sein Leben zu ret-
ten, 1933 zur Emigration gezwungen. In Paris und
Los Angeles führte er dann verschiedene Filmproduktionsfirmen unter dem prominenten Namen der
Nero-Film weiter. Die internationale Filmzeitschrift »Cahiers du Cinema«, mit Sitz Paris, führt »M –
Eine Stadt sucht einen Mörder« in ihrer Liste der 100 besten Filme aller Zeiten an prominenter 6.
Stelle. Der Name Nebenzahl, den Seymour im amerikanischen Exil zu >Nebenzal< abänderte, um
den Beiklang >deutschen Sinns< zu vermeiden, müsste – so wäre anzunehmen – in der deutschen
Filmbranche von heute noch bekannt sein, vor allem dann, wenn er sogar unvermutet in einem deut-
schen Spielfilm eine Hauptrolle erhält, die er in der Wirklichkeit – jedenfalls in dieser Geschichte nicht
– nicht gespielt hat.
Alfred Mühr (1903-1981) beschloss, nachdem
er seine Bildung auch ohne Abitur als genü-
gend ausgereift befand, Journalist zu werden.
Seiner Gesinnung entsprach die »Deutsche
Zeitung«, deren Feuilleton er nutzte, um der
Weimarer Republik den »Kulturbankrott« zu
prophezeien und eine >rechtsgeistige< Kultur
des Nationalismus zu propagieren. ║ Am 23.
März 1927 inszenierte Erwin Piscator
»Gewitter über Gotland« von Ehm Welk an
der Berliner Volksbühne. Mühr nahm diese
Inszenierung zum Anlass, dem konservativen
Bürgertum der Republik den griffigen Begriff
des »Kulturbolschewismus« zu besorgen. Mit
ihm ließen sich alle unbequemen
>Phänomene< der industrialisierten
Massengesellschaft und des sich etablieren-
den Konsumkapitalismus – wie
Gleichschaltung, Massenlenkungen,
Propaganda als Reklame und
Gehirnwäsche, Auslöschung der
Persönlichkeit – als Ausgeburt sowjetisch-bolschewistischer Gleichmacherei sowie einer linken kol-
lektivistischen Menschenverachtung erfolgreich überschreiben. ║ Von da ab versah Mühr >Kultur<
mit dem Attribut >rechtsgeistig<, mit einem Wort, das der deutsche Wortschatz zum Glück nicht auf-
genommen hat (vgl. DWDS, Das deutsche Wörterbuch von 1600 bis heute). Für ein solches Theater
reichten teutsches Blut und rechtsamer Gesichtsschnitt aus. ║ Mühr stieg auf. Er wurde 1934
Schauspieldirektor und stellvertretender Generalintendant der Preußischen Staatstheater (im Plural)
sowie Dozent an der angegliederten Schauspielschule. ║ Daneben schrieb Mühr zahlreiche Aufsätze
und Bücher, verfasste Hörspiele und drehte 1937 den Film: »Die Warschauer Zitadelle«. ║ Bis 1945
verblieb Mühr auf diesen machtbesetzten Funktionen als die >rechtsgeistige Hand< von Gustaf
Gründgens im Amt, bei jenem Gründgens, der ab 1937 von den Nazis als Generalintendant der
Preußischen Staats-theater (im Plural: es waren drei: Theater am Gendarmenmarkt, Kleines Haus,
Lustspielhaus) bestallt worden war.
Nach dem Krieg verstand es Mühr – wie etwa sein Kumpan Ernst von Salomon – sich aller
Vergangenheit zu entäußern, schrieb weiter fleißig Bücher und meldete sich erneut in seiner Rolle
als Stammesbruder deutscher Theater-Geschichte zu Wort, diesmal nicht nur als Blut-, sondern auch
als Zeitzeuge. Mit seinem Buch »Rund um den Gendarmenmarkt. Von Iffland bis Gründgens.
Zweihundert Jahre musisches Berlin«. Oldenburg: Gerhard Stalling Verlag 1965 (Stalling, ein Verlag
mit nationalsozialistischer Tradition) eignet er sich erfolgreich die >Kunst< an, seine Nazi-
Vergangenheit zu Ereignissen seiner Bürgschaft zu drehen und wenden: Jürgen Fehling und
Leopold Jeßner, die >Verwüster rechtsgeistiger Theaterkultur<, betreten in diesem Buch, aufge-
mischt als Helden, die Bühne seiner (Mührs) Theatergeschichte. Der >Kulturbolschewismus<, der
den Krieg gut genährt und in Stahlgewittern neu an- und eingefettet blendend überlebte, macht dies
möglich. Ein Nazi-Verlag stellt sich schamlos hinter diese Geschichtsklitterung und erneuert mit ihr
die »Bürgerwehr der deutschen Kultur«, die heute auch wieder »Heimatschutz« genannt wird.
So sieht Alfred Mührs >Bedeutung in der Theatergeschichte
Berlins< tatsächlich aus:
1927 kämpfte der >beste Kenner der historischen Unterlagen< an vorderster Front gegen die
>Verwüstung< des TEUTSCHEN THEATERS durch »Judenspieler«. Am 19. April verfertigte er
für die Deutsche Zeitung, Berlin, unter dem Titel »Neue Willkür im Staatstheater«, ein
Plädoyer für die Reinhaltung der Rasse an.
Walter Franck antwortete in der Vossischen Zeitung am 21. April 1927, Abendausgabe:
Der westdeutsche Kritiker Friedrich Luft schrieb 1962 in seinem Nachruf in »Theater heute«,
Heft 9: »Walter Franck schien geschaffen, alle Übeltäter, alle Brunnenvergifter, alle Schubjaks
und Teufel der großen Weltliteratur zu spielen. Und er spielte sie ziemlich alle – und er spielte
sie grandios.«
Nicht verschwiegen sei, dass ein gewisser Bertolt Brecht mit diesem Alfred Mühr Anfang September
1950 in München zusammentraf. Das Treffen habe in einem Gartenlokal von München stattgefun-
den. Dabei habe ihm Brecht – so jedenfalls berichtet es Mühr – die Leitung eines Gastspieltheaters
mit Sitz in Augsburg, einer Art AE (Augsburger Ensemble) im Westen, angeboten. Es sollte sein »ein
Brecht-Ensemble mit Schauspielern von drüben [aus der DDR], die wechseln, und hier [in Augsburg]
mit dem Stamm [residieren], auf hohem Niveau, kein Kurtheater, keine Galabühne für die Provinz,
kein Stargastspiel«. Ein weiteres Gespräch, das sie für den nächsten Tag in der Perlachstube an der
St. Peter-Kirche in Augsburg verabredet hätten, fand nicht mehr statt. Das AE blieb Gerücht (vgl.
Mühr: Deutschland, deine Söhne. München 1977, S. 309, 317).
Es könnte jedoch sein, dass Brecht über Mühr eine Verbindung zu Gustaf Gründgens herzustellen
suchte, gibt es doch das legendäre Telegramm des Rückkehrers vom 18. Januar 1949 an den ehe-
maligen Theaterleiter Gründgens von Görings Glanz und Gnaden. Es hatte den Wortlaut: »Sehr ge-
ehrter Herr Gründgens! / Sie fragten mich 1932 um die Erlaubnis, >Die heilige Johanna der
Schlachthöfe< aufführen zu dürfen. Meine Antwort ist ja. Ihr bertolt brecht«.
Die weitere Verarbeitung rechtsgeistiger Weltanschauung und ihrer Musikalität im Dreigroschenfilm
von 2018 erfolgt durch den Nachweis von Fakten. Es sind facta bruta, keine Ansichten oder
Meinungen.
Die Musik
Wie immer das Genre des Mackie-Messer-Films zu bestimmen wäre, ob als Musical, als Operette,
als Stück mit Musik, als Revue oder auch als Unterhaltungsoper, das vorhandene >Material< der ur-
sprünglichen »Dreigroschenoper« ist so umfangreich, dass es ausreichte, um mit ihm eine
Verfilmung reich und üppig zu bestücken; denn um >Stücke< im Stück ginge es nach Brecht, um
Einlagen und Auftritte, um musikalische Anstöße zum Denken, nicht um Dauergedudel und
Einlullerei.
Zu rechtfertigen ist die Neukomposition für den »Gründungssong der National Deposit Bank« durch
Kurt Schwertsik, zu dem keine Musik vorlag, weil Brechts Film ja nicht zustande kam. Wäre für die
Szenen im Ballhaus (oder wie es im Drehbuch heißt »im Tanzlokal«) noch zusätzlich Unterhaltungs-
und Tanzmusik nötig gewesen, dann hätte die vorhandene Dreigroschenmusik für zwei Filme ausge-
reicht. Allein das Angebot der orchestralen Einspielungen aus der Zeit um 1930/31 hätte mindestens
eine halbe Stunde >Hintergrundmusik< abgeben können, die Brecht allerdings rigoros ablehnte, weil
die Künste selbstständig bleiben sollten. Die >Songs< der Oper belaufen sich auf 17 Stücke. Ihre
Berücksichtigung in vollem Umfang hätte der eigentlichen Handlung kaum mehr Zeit gelassen.
Wenn sich die Macher des Films von 2018 zudem an den überlieferten Brecht-Weills-Songs der Zeit
orientiert hätten, wie sie es mit dem »Surabaya-Johnny« nicht gehalten haben – er gehört nicht zur
»Dreigroschenoper« –, dann wäre auch eine sechsstündige Wagneroper nach Brecht im Bereich des
Möglichen gewesen.
Dem Anspruch, Brechts »Vorstellung vom >Dreigroschenfilm< […] radikal, kompromisslos, politisch,
pointiert« (Presseheft, S. 7) umzusetzen, widersetzt sich politisch radikal und pointiert kompromisslos
die Tatsache, dass ein der Oper unbekanntes, aus Nazi-Diensten ererbtes Kraft-durch-Freude
Liedchen »Hoppla, Hoppla!« aus dem Jahr 1937 ins Zentrum des mehr als 2-Stunden-Opus rückt. Es
tritt an folgenden Stellen auf:
•
Szene Ballhaus (1): Carola Neher betritt betrunken das Lokal, torkelt auf die im Vordergrund
sitzende Gruppe Hauptmann-Lenya-Weill-Brecht zu, stolpert über ihre eigenen Füße – und Lotte
Lenya kommentiert spöttisch: »Hoppla!« (Filmlänge: 00:11:48).
•
Szene Ballhaus (2): Carola Neher haucht Brechts Worte »Das Leben ist wahnsinnig« dem
Film-Brecht ins Ohr. Gleichzeitig beginnt im Hintergrund orchestral das »Hoppla, Hoppla«-Lied in vol-
ler Länge und geht dann in den gesungenen Chorus über (Filmlänge: 00:11:22 bis 00:12:55). –
Carola Neher wird durch ihre Trunkenheit sowie durch den frivolen Inhalt des Liedchens als Flittchen,
in Lion Feuchtwangers Worten gesagt: als >nette, kleine Hur<, denunziert. Das Lied definiert
>Liebe< als eine Reihe von gelungenen One-Night-Stands für den Mann, während die Frauen >na-
türlich< das für sie Übliche erwarten: Treue, Liebesschwüre. Das hätte (wie die eingestreuten
Minisekunden für weibliches ObenOhne) ein Fall für MeToo werden können, wenn da nicht vorsätzli-
ches Augenschließen angesagt gewesen wäre.
•
Szene Liebe auf den ersten Griff: Der Moritatensänger (Max Raabe) singt: »Und ein Mensch
kam um die Ecke« (Filmlänge: 00:20:39); »hinter dem bewun-
derten Mädchen stehend, faßt er [Macheath] plötzlich über den
Nacken den schmalen Hals mit Daumen und Mittelfinger – allzu
geübter Griff eines Verführers der Docks«. Polly dreht sich ver-
wundert um und schaut Mac in die Augen. Das »Hoppla« bleibt
zwar unausgesprochen, wird aber durch die (scheinbare)
Wiederholung der Szene mit der Hure Jenny am Schluss des
Films (s. d.) sinnstiftend konnotiert.
•
Szene Bordell/Verrat: Die
Spelunkenjenny singt die »Seeräuber-Jenny«
als Kommentar zu ihrem Verrat an Macheath.
Dieses Lied enthält das echte »Hoppla« der
»Dreigroschenoper«. Die Szene ist eine Kopie;
sie ist übernommen aus dem Dreigroschenfilm
von G.W. Pabst, den Brecht als >Dreck< qualifi-
zierte und gegen dessen Herauskommen er
den ganzen Dreigroschenprozess angestrengt
hatte. ║▌Brecht strich den Song ersatzlos, weil
die ursprüngliche Szene und alles, was um sie
herum stattfindet, durch die Verlegung der
Hochzeit als >gesellschaftliches Ereignis< in die
Reithalle des Herzogs von Somersetshire für
den Film völlig neue Arrangements erfordert
hätte. Die Seeräuber-Romantik hatte ausge-
spielt. Der Räuber mussten längst die Regeln
der Gesellschaft beherrschen (durchweg
schlüpfrige) und Haltung einnehmen (durchweg
fragwürdige). Die Übernahme von Pabsts ei-
genwilliger Lösung für den bekanntesten Song
der Oper zieht dem Haifisch alle die Zähne aus,
die der neue Film doch wieder einsetzen wollte.
Das Foto zeigt Britta Hammelstein beim
Artikulieren des HOPPLA (Filmlänge 01:55.16).
Und es werden kommen Hundert gen Mittag an Land
Und werden in den Schatten treten
Und fangen einen jeglichen aus jeglicher Tür
Und legen in Ketten und bringen zu mir
Und fragen: »Welchen sollen wir töten?«
Und an diesem Mittag wird es still sein am Hafen
Wenn man fragt, wer wohl sterben muß
Und dann werden sie mich sagen hören: »Alle!«
Und wenn dann der Kopf fällt, sag ich: »Hoppla!«
Und das Schiff mit acht Segeln
Und mit fünfzig Kanonen
Wird entschwinden mit mir.
Ernst Blochs große Worte über die subversive Kraft des Songs in der Oper verlieren endgültig alle
radikalen Bezüge: »Der himmlische Bräutigam erscheint der Schubertchen Nonne, die hier die
Seeräuberjenny ist, als Privat, und das Hoppla ist so apokalyptisch, wie man nur will.« ║▌Dieses
Verfahren setzt unschöne
Manipulationen fort. Lotte Lenya, die den
Song in der Verfilmung von Pabst vor-
trug, wurde zur >Seeräuberjenny< und
als solche zu einer Figur der Oper, eine
Rolle, die die Handlung des Stücks nicht
kennt. Mit dieser Rolle wurde dann die
ihn vortragende Schauspielerin, Lotte
Lenya, identifiziert, so dass sie beide
nach dem Motto >Frau ist Frau< zur
Personalunion verschmolzen: Lotte
Lenya=Seeräuberjenny. Auch das be-
rühmte »Hoppla!« musste mitziehen und
als Titel für ganze Musik-Alben herhal-
ten. Sie vertreten ab 2006 die musikali-
sche »Weill-Lenya-Biographie« und
tradieren den Stoff sowie Personal auf
eine Weise, dass die ursprünglichen Zusammenhänge nicht mehr erkennbar sind. So entstehen
Phantome, die sich anstelle der realen Personen in den Köpfen eingenistet haben und >überleben<.
Die Musikindustrie und in diesem Fall die Weill-Foundation und nicht zuletzt die >interessierte<
Musikwissenschaft, hier vor allem die Weill-Spezialisten, arbeiteten daran kräftig mit.
Dieser erfolgreiche Fake hatte denn wiederum zur Folge, dass ganze Romane entstanden sind und
ihnen womöglich weitere >Narrative< nachfolgen werden. Die neueste Variante liefert die Roman-
Biografie Lotte Lenya und das Lied des Lebens von Eva Neiss, einer studierten Germanistin. Nach
der Werbung des S. Fischer Verlags, Frankfurt a. M. 2020, kennt sich Neiss in der >wechselhaften
Geschichte der 1920er und 1930er Jahre< wie auch in der >Musik dieser Zeit< blendend aus: »Lotte
Lenya ist die wohl bekannteste Sängerin der Dreigroschenoper. […] An Weills Seite gelingt ihr […]
der Durchbruch, sie lernt Bertolt Brecht kennen und spielt die Seeräuber Jenny in der
Dreigroschenoper. Doch die Liebe des Künstlerpaars ist Höhen und Tiefen ausgesetzt …«
Weiterzulesen preiswert auf 336 Seiten im Taschenbuch.
•
Szene an der Themse/Moritatensänger: Mac ist – wie ein Pop-Star (so versteht es die Regie)
– ein bekannter und gesellschaftlich allgemein anerkannter Mann (= Boss) geworden und verteilt
stolz Autogrammkärtchen mit seinem Bildnis (wie sinnig). Erneut wackelt ein (weiblicher) Hintern vor-
bei, dem der hohe Herr Bankier mangels profaner (= nicht geldgetränkter) Gelegenheiten wieder ein-
mal nicht auszuweichen vermag. Er wird aber diesmal nicht beschließen, auch diesen Hintern zu
heiraten, den >allzu geübten Griff eines Verführers der Docks< lässt er sich nicht entgehen, müssen
doch die alten Gewohnheiten bei allen Wandlungen und Verwandlungen
weiterhin geehrt werden. Diesmal greift er daneben: »Hoppla!
Verzeihung, ein Versehen, tut mir leid« (Vorsicht: Ironie). Wow! Es ist
Jenny’s Hintern. Dieser wird freilich erst an ihrem Gesicht kenntlich, ob-
wohl Mac diesen Hintern doch hoppla-hopp, auch unterm Kleid ohne weiteres, wie heißt schon bib-
lisch? >erkennen<, genauer: wiedererkennen sollte
(Filmlänge: 02:04:52).
Bleibt noch der Trailer: Nach kitschiger Auftakt-Musik nach dem Motto >Eine Nacht in Venedig auf
der Themse unter den Mondgesichtern von Soho<, die mit sägenden Geigen falsche Romantik an-
deuten soll, geht die Musik orchestral über in das »Hoppla, Hoppla!«-Lied und stimmt das Publikum
ganz im Sinn des Komponisten Werner Bochmann »graziös, aber sehr rhythmisch« in den Takt
des Films ein.
Foxtrott ist angesagt, der mit wenigen Schritten auskommende Gesellschafts- und Paartanz,
der auch bei >einfachen Gemütern< ins Blut geht und in der Regel der Tanz bleibt, der von
>allen< einigermaßen >beherrscht< werden kann. »Mit seinen frohen und natürlichen
Bewegungen gehört der Foxtrott zu den Favoriten
des volkstümlichen Tanzes und ist leicht zu lernen.
Der Schieber, wie er auch genannt wird, sticht
durch seine Einfachheit hervor und begeistert mit
geschmeidigen Bewegungen sowie lockeren vor-
wärts und rückwärts Schritten, was sich als auch
als ein Schieben am Ort bezeichnen ließe, deshalb
wohl: Schieber, der bei den Bayern auch als
>Schuhplattler< durchgeht«
(Auszüge aus offiziellen Beschreibungen für Tanzschulen).
Hopla, hopla! Heute schenk ich dir mein Herz für
eine Nacht! /
Meine Liebe, meine Küsse haben oft schon Glück
gebracht, /
Hopla, hopla! Du wirst glauben, keiner liebt dich so
wie ich! /
Aber treu sein, Liebling, treu sein, ist ein Ding für
sich! /
Heut verschenk ich meinen Mund für die Nacht! /
Süße Stunden bis der Morgen erwacht! /
Keine Schwüre, keine Treue, nur der kurze
Augenblick! /
Hopla, hopla! Das ist Leben, eine Nacht voll Glück.
(Transkription nach nebenstehender Partitur;
Filmlänge: 00:11:52-00:12:23)
Die Laufzeit der Musik-Einspielung im Trailer beträgt 18 Sekunden (von 2:20 = 140 Sekunden). Sie
hat damit über zehn Prozent Anteil am gesamten offiziellen Werbe-Videoclip – mehr als jeder dort zi-
tierte Brecht-Weill-Song. ▐║Fazit: Das »Hoppla, Hoppla!«-Lied erhält im Film mit einer Laufzeit von
zwei Stunden und 13 Minuten, ausdrücklich bestätigt durch seinen Trailer, den Charakter nicht nur
eines musikalischen, sondern auch eines inhaltlichen Leitmotivs, das durch die markanten
Wiederholungen symbolische Bedeutung beansprucht.
Das aktuelle Wörterbuch vermeldet unter >Worthäufigkeit<: selten, und gibt als Beispielssätze
an: (1) »Hoppla! Das war keine Absicht, Entschuldigung«. (2) »In diesem Sinne fasse ich zu-
sammen… — hoppla, jetzt hätte ich fast mein Glas umgestoßen.
Wo war ich stehen geblieben?«
Über das Lied ergeben sich Zusammenhänge und Verbindungen. Es stammt, wie es das Label aus-
weist, aus dem Film »Die Warschauer Zitadelle« von 1937, und wird im Film eingesetzt für eine ge-
spielte Zeit, die vom 31. August 1928 (= Premiere der »Dreigroschenoper«) über Mai 1930 (=
Abschluss des Vertrags mit Nero), über Oktober/November
1930 (= Gerichtsprozess) bis zum 28. Februar 1933 (=
Reichstagsbrand/Flucht) reicht. Musik spricht nachweislich in
erster Linie Gefühle (ohne Worte) an und hält zu gemüthaftem
Einschwingen ins filmisch Dargestellte an. Wird sie dann noch
mit Bedeutung versehen – hier als Leitmotiv eingesetzt –,
wirkt Musik besonders einfühlsam und nachhaltig.
Das »Hoppla«-Lied bediente im Nazi-Film die Verschleierung
von ideologisch-kriegtreiberischen Tendenzen im historischen
Gewand durch seine scheinbare (frivol) angehauchte
Leichtigkeit, die im musikalischen Rhythmus ihren zusätzli-
chen emotionalen Ausdruck fand. Über den Film, dessen
Nazi-Ideologie die Goebbels-Zentrale mit dem Prädikat
»Politisch wertvoll« ausdrücklich bestätigte, wurde das Lied
unabhängig vom Film im Rahmen der >Kraft-durch-Freude<-Mobilisierung des >deutschen Volks<
für den – da bereits offen vorbereiteten – Krieg ein erfolgreicher Schlager. Er hatte Lebensfreude zu
vermitteln, damit der herrschende Terror nicht so sehr auffiel. Der Film hatte am 6. September 1937
Premiere in Berlin, im Ufa-Palast.
Das >künstlerische< Verfahren der heutigen Filmemacher heißt: Anachronismus, in diesem Fall:
vorgreifender Anachronismus. Es handelt sich beim »Hoppla«-Lied folglich um eine historische
Einordnung im Vorgriff auf eine Zeit, in der bereits ganz andere Zustände herrschten und Brecht
längst im Exil (hier noch: Dänemark) war, kurz: um eine historische Fälschung. Da diese
Geschichtsklitterung im Presseheft auch noch nachdrücklich als >radikal< und >politisch< qualifiziert
wird, muss bei allen Beteiligten des – von der FBW mit dem Prädikat »Besonders wertvoll« ausge-
zeichneten – Films entweder rechtsgeistige Verwirrung oder tiefgründige Ahnungslosigkeit geherrscht
haben.
Doch damit nicht genug. Je
weiter ich den Quellen nach-
gehe, um so dubioser wer-
den die Verbindungen, die
der Film selbst herstellt. Der
beanspruchte »Blick hinter
die Kulissen der historischen
Ereignisse damals« (laut
FBW-Urkunde) legt
Zusammenhänge frei, die
sich mit >künstlerischer
Freiheit< nur sehr schwer
rechtfertigen lassen. Im Gegenteil: In
der »Verbindung des literarhistori-
schen Stoffes mit aktuellen gesell-
schaftlichen Konflikten« (so die FBW-
Urkunde) kommt unverdauter politisch-
ideologischer Müll zum Vorschein,
der heutigen Antisemitismus und
Rassismus bedient.
Anspruch und Programmatik unter-
streicht nochmals – nach den Texten
des Vorspanns (Filmlänge: 00:00:58) –
der Film-Brecht am Steuer seines
Autos: »Wir spielen, was hinter den
Vorgängen vorgeht. Eine einfache
Wiedergabe der Realität reicht nicht
aus.« (Filmlänge: 00:13:48-54).
Die Damen (Hauptmann-Lenya-Neher) auf der Rückbank bestätigen im eingeübten Chor von braven
Schülerinnen dem Meister seine uneingeschränkte Autorität. »Wir haben verstanden, Herr Brecht«.
Brecht nimmt die Litanei zufrieden zur Kenntnis (Filmlänge: 00:13:56), und die Damen sagen ihre ge-
lernte Lektion weiter auf: »Eine Fotografie der Kruppwerke oder der AEG ergibt beinahe nichts über
diese Institute. Wir müssen also etwas Künstliches aufbauen. Es ist Kunst nötig.«
Die Zitate sind zusammengesetzt aus folgenden Werkteilen Brechts: »Spielen, was hinter den Vorgängen vorgeht«, Titel
eins Notats über Schauspielkunst von 1939 = GBA 22,519, und »Die Lage wird dadurch so kompliziert, daß weniger denn je
eine einfache >Wiedergabe der Realität< etwas über Realität aussagt. Eine Fotografie der Kruppwerke oder der AEG ergibt
beinahe nichts über diese Institute. Die eigentliche Realität ist in die Funktionale gerutscht. Die Verdinglichung der menschli-
chen Beziehungen, also etwa die Fabrik, gibt die letzteren nicht mehr heraus. Es ist also tatsächlich >etwas aufzubauen<,
etwas >Künstliches<, >Gestelltes<. Es ist also ebenso tatsächlich Kunst nötig.« (Aus »Der Dreigroschenprozeß« von 1931 =
GBA 21,469.)
An dieser Stelle hat M wie Nazi, Alfred Mühr, seinen nächsten zweifelhaften Auftritt. Mühr schrieb
1936 ein Drama mit dem Titel »Der weiße Adler. Schauspiel nach d. poln. Bühnenwerk >Tandem< d.
G. Zapolska« (Angabe nach der Deutschen Bibliothek). Das Drama prädestinierte Mühr zum
Verfasser eines Auftragsfilms der A.B.C.-Filmgesellschaft, Sitz Berlin, die 1933, also im Jahr der
>Machtergreifung< gegründet worden war: »Die Warschauer Zitadelle«. Fritz Peter Buch führte
Regie. Buch gehörte zum ausgewiesenen, ideologisch zuverlässigen >künstlerischen Nachwuchs<,
den die Goebbels-Zentrale für Propaganda und >Volksaufklärung< benötigte, um die personellen
>Verluste< auszugleichen, den sich die Nazis durch Berufsverbote und Vertreibung geleistet hatte.
Buch verstand es, im historischen Gewand aktuelle Themen unterhaltsam aufzubereiten und dazu
schwungvolle Musik nach der Nazi-Maxime >Kraft-durch-Freude< einzusetzen. Sein Film »Jakko«
von 1941, die Geschichte eines haltlosen Zirkusknaben, der in der >Hitler-Jugend< zu Zucht,
Ordnung und Heimat findet, steht noch heute auf der Liste der so genannten >Vorbehaltsfilme<, die
wegen ihres Rassismus und Antisemitismus zu den >harten< und noch immer unterschwellig gefähr-
lichen Fällen der Nazis-Propaganda zählen und
deshalb nur unter Aufsicht von Fachleuten mit ent-
sprechender Aufklärung vorgeführt werden dürfen.
Dieser Film erhielt vom Goebbels-Ministerium die
Auszeichnungen: »staatspolitisch wertvoll«,
»volkstümlich wertvoll« sowie »jugendwert«. Mit
dem letzten Prädikat empfahl er sich als Lehrfilm
für Filmveranstaltungen der
>Reichsjugendführung<.
»Die Warschauer Zitadelle« benutzte Buch, um
mit einem historisch verbürgten Freiheitskampf in
Polen massiv antisowjetische Propaganda zu be-
treiben und dabei >den< Russen als
Untermenschen zu denunzieren. Da zum Film
(damals) die Liebesgeschichte obligatorisch gehörte, benötigte der polnische Freiheitskämpfer weibli-
che Unterstützung, deren soziale Herkunft ein wenig zweifelhaft ist, aber durch den >Helden< am
Ende in reiner Liebe geläutert wird. Die Sache muss tragisch ausgehen, damit in den Gemütern des
Publikums ein tief sitzender Eindruck verbliebe. Das »Hoppla, Hoppla!«-Lied diente mit seinem ein-
gängigen Rhythmus des Hin- und Zurück bzw. des Auf- und Ab als Aufmunterung zur eigenen Tat.
1937 gedreht, setzten die Nazi-Usurpatoren diesen Film unmittelbar nach dem >Anschluss<
Österreichs mit Massenkopien ab April 1938 im neuen erweiterten >Großdeutschen Reich< ein, um
nicht nur den >befreiten< Österreichern, sondern nun allen, endlich wieder Gesamt-Teutschen zu
suggerieren, sie hätten >sich selbst befreit<. Schließlich stammte ihr neuer >Führer< aus Österreich.
Um diese Zeit durfte es sogar noch ein Kampf nationalistischer Polen gegen die russische
Bolschewisten-Herrschaft sein. Keine zwei Jahre später gehörten sie zu den offen deklarierten
>Untermenschen<. Der Film wurde übrigens deshalb, weil er in Polen spielte, kein Erfolg. Der >an-
gestammte< Rassismus im >deutschen Menschen< machte es schwer, in den sprichwörtlichen
>Polacken< Freiheitskämpfer zu sehen, mit denen man sich identifizieren könnte. Dies spricht aber
nicht für den Film und auch nicht dafür, dass er auf der >Vorbehaltsliste< nicht erscheint, und schon
gar nicht dafür, ausgerechnet sein Erkennungslied zum Leitmotiv eines neuen Brecht-Films zu
erheben.
Die Medien
Als »Wissenschaftliche Beratung« zeichnen Joachim Lucchesi und Jürgen Schebera (Filmlänge:
02:05:29). Beide sind Musikwissenschaftler, beide sind fachwissenschaftlich hervorragend ausgewie-
sen, haben in der DDR ihre Ausbildung erhalten und verstanden es, sich auch nach der Wende im
wieder vereinigten Deutschland neu zu etablieren. Lucchesi hat u.a. das Standardwerk »Musik bei
Brecht« verfasst, das 1988 in der DDR und in der Bundesrepublik gleichzeitig erschien. Jürgen
Schebera zeichnet vor allem als Weill-Spezialist und war einer der maßgeblichen Mitarbeiter an der
gesamtdeutschen Großen Brecht-Ausgabe (GBA), die 1985 vertraglich vereinbart wurde und zu den
– damals als sensationell eingestuften – recht einsamen deutsch-deutschen Gemeinschaftsprojekten
kultureller Art zählte.
Schebera gehört zu den Verfechtern der – nach seiner Meinung von Brecht herabgestuften – hohen
Weill-Anteile an der »Dreigroschenoper«, die er weiterhin mit 80 Prozent einstuft. Entsprechend ver-
tritt er die Ansprüche der »Weill-Foundation«, die, wie die Brecht Erben im Hinblick auf das originale
Wort, streng darauf achteten, dass die Originalversionen der Weill’schen Arrangements in allen – von
ihr habhaft zu machenden – Inszenierungen erhalten blieben. Das führte immer wieder – wie bei den
Brecht-Erben – zu gerichtlichen Auseinandersetzungen, die stets zugunsten der >Nachlass-
Verwalter< ausgingen, auch weil die zuständigen Verlage, nämlich Suhrkamp (ehemals Frankfurt a.
M.) und die Universal-Edition (Wien) sklavisch zu ihren >Urhebern< standen und damit eine produk-
tive Weiterentwicklung der Brecht-Weill-Künste verhinderten. Dies hatte für nicht wenige
KünstlerInnen sowohl der Bühne als auch der Musik die Konsequenz, ganz auf neue Aufführungen
von Weill-Brecht zu verzichten.
Die Folgen für den aktuellen Dreigroschenfilm waren – für die Musik: Die SchauspielerInnen mussten
die Gesangspartien übernehmen, – für den Text: Es durften nur Brecht-Texte gesprochen werden.
Brecht bestand in seinem Treatment zum Film, »Die Beule«, wie auch in seinen sonstigen theoreti-
schen Äußerungen zu den Medien und ihren Einfluss auf die Künste mit Nachdruck darauf, die
Möglichkeiten – hier von Bühne und Film –
nicht miteinander zu verwischen.
Denn, so Brechts Begründungen, singende SchauspielerInnen sowie Texte direkter Ansprache für
die Bühne fänden sich von vornherein, versetzt in einen Film, im falschen Medium wieder, und zwar
aus ganz objektiven Gründen. Die Ton-Technik des Films treibt alle – bei Schauspielern nun einmal
vorhandenen – Mängel des Gesangs unerbittlich heraus. Texte, die bei unmittelbarer Artikulation mit
dem ganzen Einsatz der Körper auf und von der Bühne gesprochen werden, rascheln auf der
Leinwand unnachsichtlich mit dem Papier, von dem aus sie memoriert wurden. Kritiken, die ansons-
ten vor dem falschen Anspruch des Films kapitulierten, bemerken immerhin wiederholt die man-
gelnde Tontechnik des Mackie-Messer-Films, wie sie auch den bemühten Gesang und seine
Misstöne herausheben. Für den unablässig Brechts geflügelte Worte ableiernden Lars Eidinger fand
ein Kritiker das schöne Bild einer >wandelnden Glückskeksdruckerei< (Matthias Heine). Es ist die
Mechanik der Apparate, die sich bei einem unterforderten großen Schauspieler unbewusst durch-
setzt und seine Fähigkeiten eindeutig >unterflügelt<.
Brecht führte für diese ästhetische Grundsatzfrage der Kulturindustrie im 20. Jahrhundert den nicht
im DUDEN verzeichneten Begriff »Technifizierung« ein, nicht »Technisierung« (womit er verwech-
selt zu werden pflegt). Der Begriff besagt, dass die poetische Sprache sowie das darstellende
Theater für das, was die technischen Medien, hier der Film, mit ihren Apparaten an darstellerischen
Mitteln und Formen produzieren, eigene sprachliche und theatralische Entsprechungen finden müs-
sen, um nicht in verfehlte Nachahmungen oder in >einfache Übertragungen< zu verfallen und damit
dem Medium nicht angemessen sind. Umgekehrt heißt dies aber auch, dass der Film von vorherein
die verkürzenden, einseitigen und mechanisierten Abläufe der >Formate< der Filmgerätschaften,
auch wenn diese inzwischen digital verfahren, berücksichtigen und beim Spiel der SchauspielerInnen
sowie bei der Umsetzung der Musik in dessen Technik einbauen müssen.
>Live< im Kunst-Film zu suggerieren ist ein Lehrlingsfehler. Der entlarvt sich hier in den unsäglichen,
ironisch gemeinten Tanzszenen, beim Hochzeitsmahl, das mit fressenden Ganoven und ihren ver-
fehlten Tischsitten nicht mehr zum Ambiente passt, und vor allem im geradezu peinlichen Auftritt des
weiblichen Bankvorstands: Die als Püppchen aufgetakelte, stockfuchtelnde Dame muss Haltung auf-
setzen zu Worten, die aus dem falschen Stück, also der Oper, stammen und so überzeugend dane-
ben klingen, wie die ständig durch den Film wiegenden Hintern, keinen noch so geilen Hund hinterm
Ofen vorlocken können (vgl. Filmlänge: 01:43:01ff.).
Die
uns
so
abraten,
diese
neuen
Apparate
zu
benützen,
bestätigen
diesen
Apparaten
das
Recht,
schlecht
zu
arbeiten,
und
vergessen
sich
selber
vor
lauter
Objektivität:
denn
sie
geben
sich
damit
zufrieden,
dass
nur
Dreck
für
sie
produziert
wird.
Uns
aber
nehmen
sie
von
vorn
-
herein
die
Apparate
weg,
deren
wir
zu
unserer
Produktion
bedürfen,
denn
immer
weiter
doch
wird
diese
Art
des
Produzierens
die
bisherige
ablösen,
durch
immer
dichtere
Medien
werden
wir
zu
sprechen,
mit
immer
unzureichenderen
Mitteln
werden
wir
das
zu
Sagende
auszudrü
-
cken
gezwungen
sein.
Die
alten
Formen
der
Übermittlung
nämlich
bleiben
durch
neu
auftau
-
chende
nicht
unverändert
du
nicht
neben
ihnen
bestehen.
Der
Filmesehende
liest
Erzählungen
anders.
Aber
auch
der
Erzählungen
schreibt,
ist
seinerseits
ein
Filmesehender.
Die
Technifizierung
der
literarischen
Produktion
ist
nicht
mehr
rückgängig
zu
machen.
Die
Verwendung
von
Instrumenten
bringt
auch
den
Romanschreiber,
der
sie
selbst
nicht
verwen
-
det,
dazu,
das,
was
die
Instrumente
können,
ebenfalls
können
zu
wollen,
das
,
was
sie
zeigen
(oder
zeigen
könnten),
zu
jener
Realität
zu
rechnen,
die
seinen
Stoff
ausmacht,
vor
allem
aber
seiner
eigenen
Haltung
beim
Schreiben
den
Charakter
des
Instrumentebenützens
zu
verlei
-
hen. (GBA 21,464)
Der Dreigroschenfilm von 2018 ist bereits im Ansatz künstlerisch verfehlt und fördert wirres ideologi-
sches Denken. Ihn für den staatlichen Bildungsauftrag zu empfehlen und öffentlich sowie an Schulen
einzusetzen, verhöhnt unsere Demokratie.
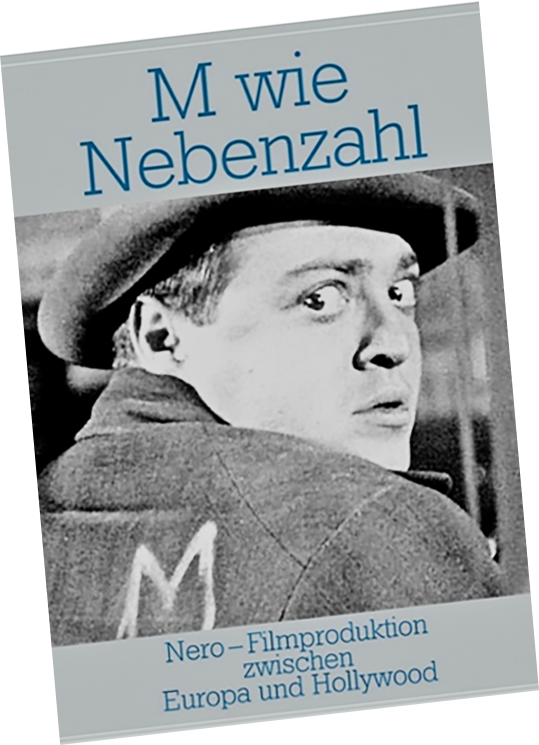



Caspar Neher »Die
Bekehrung des
Saulus«; um 1920;
Erstdruck
Es
ist
ganz
besonders
zu
begrüßen,
daß
sich
Alfred
Mühr
dieser
großen
Aufgabe
unterzogen
hat,
die
Geschichte
des
Schauspielhauses
am
Berliner
Gendarmenmarkt
zu
schreiben.
Durch
seine
Wirksamkeit
als
Schauspieldirektor
und
stellvertreten
-
der
Generalintendant
dieses
Theaters
im
letzten
Jahrzehnt
des
Hauses
und
als
bester
Kenner
der
his
-
torischen
Unterlagen
war
er
geradezu
dafür
prädesti
-
niert.
Dieses
so
unterhaltsam
geschriebene
Werk
führt
den
Leser
durch
die
zwei
Jahrhunderte
eines
der
bedeutendsten
deutschen
Theater,
das
am
schönsten
Platz
des
alten
Berlin
gelegen
war.
Beginnend
mit
dem
zwischen
dem
Französischen
und
Deutschen
Dom
auf
dem
Gendarmen-markt
ge
-
legenen
Pferdestall
unter
Friedrich
Wilhelm
I.,
als
der
Athlet
Eckenberg
als
„Hofschauspieler"
mit
seiner,
mehr
Artisten
als
Komödianten
zählenden
Truppe
auftrat,
wird
die
Gründung
des
Theaters
durch
Friedrich
den
Großen
eingehend
geschildert.
Der
große
künstlerische
Aufstieg
dieser
Bühne
setzte
ein,
als
August
Wilhelm
Iffland
aus
Mannheim
von
Friedrich
Wilhelm
II.
als
Direktor
an
die
Spitze
des
Theaters
im
Jahre
1796
berufen
wurde.
Alle
großen
Künstlernamen
erscheinen
hier
wie
Fleck,
Franz
Brockemann,
verschiedene
Primadonnen,
Ludwig
Devrient,
der
Freund
von
E.
T.
A.
Hoffmann,
Seydelmann,
Spontini
und
Carl
Maria
v.
Weber.
Mit
seinem
„Freischütz"
fand
die
feierliche
Einweihung
des
Schinkelbaues,
dieses
ar
-
chitektonisch
schönsten
Berliner
Theaters,
1821
statt.
Auf
die
Zeit
des
„Königlichen
Schauspielhauses"
mit
seinem
mehr
traditionsgebundenen
Repertoire
folgte
in
der
Weimarer
Zeit
die
Ära
Leopold
Jessner
und
schließlich
die
Ära
Gustaf
Gründgens.
Alle
bedeutenden
Schauspieler
treten
auf,
ob
Adalbert
Matkowsky
oder
Friedrich
Kayssler,
Werner
Krauss
oder
Paul
Hartmann,
Heinrich
George,
Lothar
Müthel
und
Viktor
de
Kowa,
Hermine
Körner
und
Maria
Koppenhöfer
sowie
Tilla
Durieux,
um
nur
einige
zu
nennen.
Besonders
ausführlich
wird
die
letzte
Periode
behandelt
mit
dem
großen
Regisseur
Jürgen
Fehling
und
vor
allem
Gustaf
Gründgens,
der
den
Verfasser
in
seine
Position
berufen
hatte
und
mit
dem
er
das
letzte
Jahrzehnt
bis
zum
Zusammenbruch
gearbeitet
hatte.
In
sichtlicher
Verehrung
geleitet
Mühr
dessen
Lebensweg
bis
zu
seinem
plötzlichen
Ende
in
Manila.
Wenn
auch
für
den
Verfasser
freilich
somit
ein
Hauptakzent
seiner
eingehenden
Darstellung
auf
der
von
ihm
selbst
miterlebten
letzten
Epoche
liegt,
so
gibt
das
Ganze
doch
einen
allumfassenden
Überblick
über
die
Geschichte
dieses,
neben
dem
Opernhause,
prominentesten
Berliner
Theaters.
Ein
großer
verdienstvoller
Wurf,
für
den
man
Alfred
Mühr
nur
dankbar
sein
kann
und der seine Bedeutung in der Theatergeschichte Berlins behalten wird.

»Die
deutsche
Dichtung
wird
vom
Intendanten
des
preußi
-
schen
Staatstheaters
[=
Leopold
Jeßner]
unnachsichtlich
verwüstet.
Zur
Besänftigung
der
Gemüter
soll
eine
Neueinstudierung
von
Hauptmanns
Bauernkriegs-Tragödie
>Florian
Geyer<
dienen.
Das
Drama
ist
deutsch
im
Motiv,
deutsch
in
seiner
Gestalt,
deutsch
in
der
Melodie
,
–
mag
man
auch
diese
und
jene
empfindlichen
Mängel
bemerken.
Als
Hauptdarsteller
wurde
Walter
Franck,
eine
ausgesprochen
jüdische
Erscheinung
ver
-
pflichtet.
In
Berliner
Theaterkreisen
nennt
man
Franck
den
Judenspieler.
Das
sagt
nichts
gegen
seine
Begabung,
um
-
grenzt
aber
entscheidend
die
Rollenauswahl.
Unmöglich
ist
es,
daß
eine
Jude
eine
so
markante
Heldengestalt
wie
Florian
Geyer
dem
Wesen
nach
erfaßt
und
gestal
-
tet.
Wir
versuchen
auch
nicht,
den
Spielplan
des
Herrnfeld-Theaters
[bekanntes
>jüdisches<
Theater
in
Berlin]
nachzuahmen!
Nicht
nur
Grenzen
der
Begabung,
sondern
auch
die
Grenzen
des
Blutes,
des
Wesens
müssen beachtet, geachtet
werden.
Walter
Franck
ist
ein
eigenartiger
Schauspieler.
Mit
Fritz
Kortner
verbindet
ihn
die
Gleichheit
des
Charakters
und
die
Ähnlichkeit
im
seltsamen
Gesichtsschnitt.
[…]
Bei
dem
Schauspieler
liegt
die
Schuld,
den
Rollenauftrag
angenommen,
bei
Leopold
Jeßner
die
Taktlosigkeit,
Walter
Franck als Florian Geyer ausersehen zu haben.
Wir
erlebten
schon
einmal
eine
derartige
Stilverwüstung.
Es
war
in
Hebbels
>Nibelungen<
[Staatliches
Schauspielhaus
Berlin,
8.
April
1924,
Regie:
Jürgen
Fehling].
Fehling
bekam
als
Brünhilde
eine
jüdische
Darstellerin
zu
Verfügung
[Ida
Maria
Sachs].
Sie
zerstörte
den
Gesamtcharakter
der
Vorstellung
und
wurde
von
der
Berliner
Presse
einmütig
abgelehnt.
[Fehling
behauptete
mit
dieser
Inszenierung
das
Theater
gegen
die
zunehmende,
auf
das
Theater
rückwirkende
Suggestion
des
Films.
Der
zweite
Teil
des
Film
>Die
Nibelungen<
wurde damals als ein >deutsches Ereignis< im Berliner Ufa-Palast am Zoo uraufgeführt.]
Nun
erleben
wir
wieder
einen
solchen
Fall.
Er
fordert
zur
Abwehr
heraus,
zum
Widerstand.
Herr
Jeßner
[Leopold
Jeßner,
der
Intendant]
erlaubt
sich
alles.
Es
steht
in
seiner
Macht
–
und
wir, wir brechen nicht diese Macht, halten sie schon acht Jahre aus!
Aber
wir
werden
sie
stürzen!
Die
Mobilmachung
unserer
Kreise
hat
begonnen.
An
jeden
ein
-
zelnen
richtet
sich
unser
Appell.
Jeder
einzelne
hat
die
Pflicht,
sich
bereit
zu
halten
für
die
Bürgerwehr der deutschen Kultur.












HOPPLA!
Nur ein Versehen??
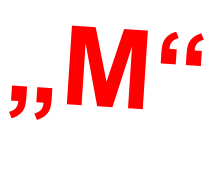
Walter Franckals Macbeth im Berliner Hebbel-Theater 1945




BRECHTLEBTAKTUELL 27. Mai 2021

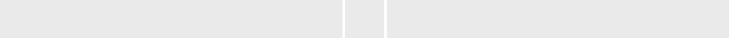



Alle Beiträge auf einen Blick!
AKTUELL Mit „Schalömchen“ gegen Antisemitismus