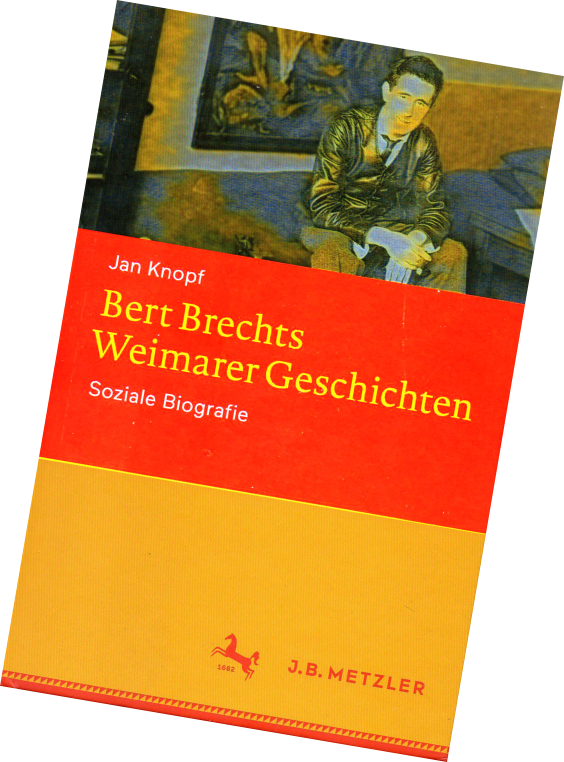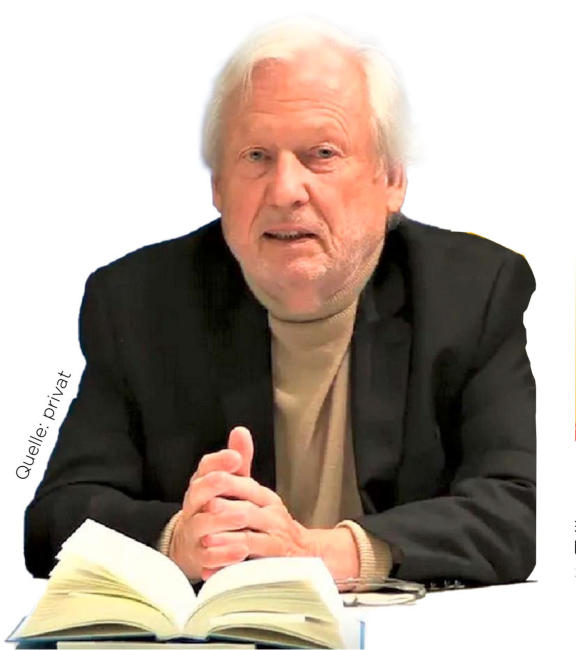

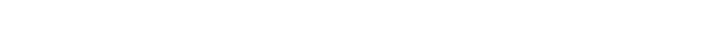
Gemeinhin wird alles, was Bertolt Brecht vor dem 31.
August 1928, der Uraufführung der „Dreigroschenoper“
am Theater am Schiff-bauerdamm in Berlin, an Dramen,
Gedichten und Liedtexten verfasst hat, wie eine Art
Vorspiel zum großen Durch- und Aufbruch seiner
Weltkarriere behandelt. Dass man das auch ganz anders
handhaben kann, beweist der Literaturwissenschaftler
Jan Knopf auf grandiose Weise mit „Bert Brechts
Weimarer Geschichten: Soziale Biografie“.
Brecht und Musik
Brecht von der Musik her denken, von seinen
Gedichten, deren Verse er schuf oder gar
schmiedete, während er auf einer Wandergitarre
dazu Akkorde anschlug. Wer sich über die
Klanghaftigkeit seiner Strophen wundert, sollte
deren Entstehung im Auge behalten. Wie etwa
Jan Knopf, der Brecht mit dessen Art zu dichten
als „Singer/Songwriter“ an die Seite von Bob
Dylan und somit in einen popkulturellen
Kontext stellt, von dem im engeren Sinne erst
ab Ende der 1940er Jahre – mit dem
Aufkommen von Massenidolen wie Frank
Sinatra und der explosionsartigen Ausweitung
der Schallplattenindustrie in den
prosperierenden 1950er Jahren – gesprochen
werden kann.
Jahrzehnte vorher gab es vergleichbare
Phänomene: Hits, die alle kannten und
mitsangen. Musikverlage, die dafür Noten
herausbrachten. Auch Tonträger gab es
bereits in Form von Schellackplatten, die
tausendfach über die Ladentische von
Musik-fachgeschäften gingen, und die auf
tragbaren Grammophonen sogar im
Schwimmbad oder am Strand abgespielt werden konnten.
Für den Auftakt seiner „sozialen Biografie“ über Brechts Weimarer Jahre
wählt Knopf Brechts Eisenbahnfahrt nach Berlin im Februar 1920. Dabei soll die erste Fassung
seines Gedichtes „Erinnerung an die Marie A.“ entstanden sein, für das er einen alten französischen Schlager
von Charles Malo mit dem Titel „Tu ne m’aimais pas“ als Vorlage nutzte.
Mit dem Vergleich zwischen Malos Gassenhauer und dem, was der Dichter daraus machte (und erstmals 1927 in
„Bertolt Brechts Haus-postille“ mit Noten veröffentlichte) sowie dem, was heute noch an zeitgeschichtlichem
Kontext realisiert werden kann, ist exemplarisch nachvollziehbar, wie der Autor sein etwas abseits der
ausgetretenen Brecht-Forschungspfade angelegtes Sujet auch methodisch ungemein dicht darzustellen vermag.
Aus Luxemburger Tageblatt, 29. September 2025, Seite 8
„Bert Brechts Weimarer Geschichten“
Brecht ist Pop
Der Autor und Literaturwissenschaftler Jan Knopf