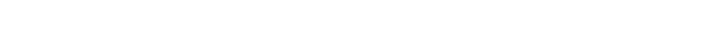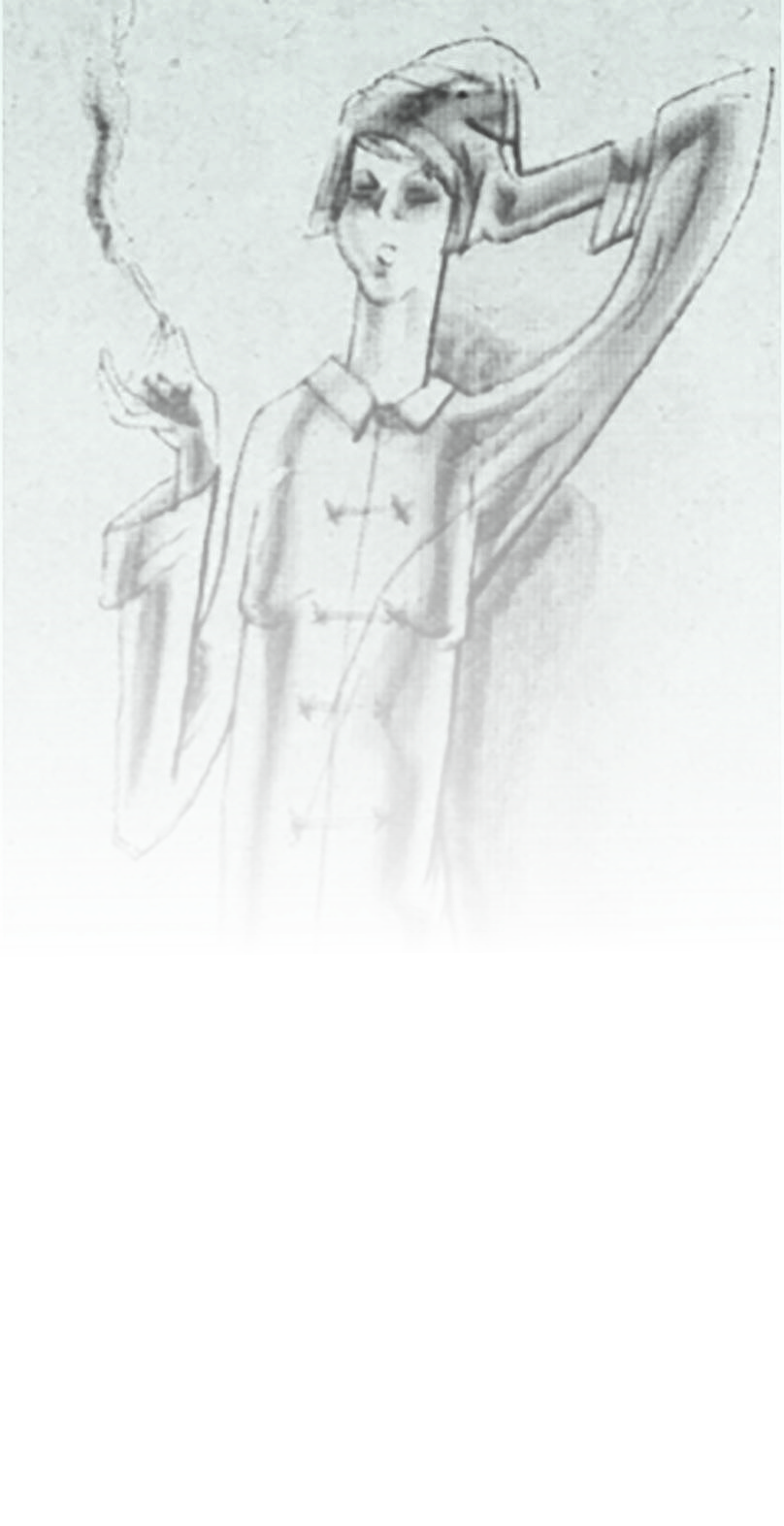
»Ich dachte lange darüber nach, wie diese Geschichte heißt. Aber dann
wußte ich, daß sie >Barbara< heißt. Ich gebe zu, daß Barbara selber nur
ganz am Anfang vorkommt und die ganze Geschichte hindurch in viel zu
schlechtem Lichte dasteht, aber die Geschichte kann gar nicht anders
heißen als >Barbara<.
Edmund, genannt Eddi, 200 Pfund
schwer, Melancholiker, tat sehr unrecht,
mich abends neun Uhr, nur weil wir ein
paar Kurfürstendamm-Cocktails
zusammen geschluckt hatten und sein
Chrysler vor der Bar stand, in die
Lietzenburger Straße 53 zu Barbara
mitzunehmen, obwohl er wissen mußte,
daß Barbara eine >sehr wichtige
Unterredung mit einem Kabarettdirektor<
hatte.« (GBA 19,280; bitte dort
weiterlesen)
Das ist nicht BARBARA:
Barbar(a) ist abgeleitet von
Altgriechisch: βάρβαρος
bárbaros und bezeichnete in
der Antike diejenigen, die nicht
(oder schlecht) Griechisch
sprachen (wörtlich: Stammler,
Stotterer). Später wurde die
Bedeutung übertragen auf alle
>Völker<, die, weil sie die
Sprache nicht beherrschten,
als nicht gebildet, als >kulturell
niedrig< (doof, ungehobelt,
unsittlich und so weiter)
eingestuft und deshalb auch
als >Menschen niederer
Sorte< (bei den Nazis: >Art<)
behandelt wurden. Wikipedia
belehrt uns: »Im modernen
Sprachgebrauch wird der
Begriff abfällig in der
Bedeutung >roh-unzivilisierte,
ungebildete Menschen<
verwendet. Der Begriff
>Barbar< […] bzw.
>Barbarentum< dient seit Beginn der Antike innerhalb eines helleno- bzw. ethnozentrischen
Weltbildes als abgrenzende und abwertende Bezeichnung für die Andersartigkeit fremder Kulturen,
seien sie in regionaler […] oder weltanschaulicher (Juden, Christen, >Heiden<) Distanz. Parallel dazu
geht eine stark rhetorisch-propagandistisch aufgeladene Verwendung des Begriffs […].«
Das auch nicht.
Das ist keine Produktplatzierung, sondern schlicht und ungesetzlich Schleichwerbung.
Der schnellste Sportwagen der Welt: BMW 1944
Eine hervorragende Leistung der deutschen Kraftfahrt-Durch-Freude-Industrie!
Wohlgeformt und angriffslustig. Wir halten mit und durch.
Aus der »Dreigroschenoper« (Erstdruck 1928)
(Song-Beleuchtung. Auf den Tafeln erscheint: Durch ein kleines Lied deutet Polly ihren Eltern ihre
Verheiratung mit dem Räuber Macheath an.)
NR. 9. BARBARA-SONG
Einst glaubte ich, als ich noch unschuldig war,
Und das war ich einst grad sowie du –
Vielleicht kommt auch zu mir einmal einer,
und dann muß ich wissen, was ich tu.
Und wenn er Geld hatte,
Und wenn er nett war,
und sein Kragen ist auch werktags rein,
Und wenn er wußte, was
Sich bei einer Dame schickt,
Dann sagte ich ihm: »Nein«.
Da behält man seinen Kopf oben
Und man bleibt ganz allgemein.
Sicher schien der Mond die ganze Nacht,
Sicher wird das Boot am Ufer festgemacht
Aber weiter kann nichts sein.
Ja, da kann man sich doch nicht nur hinlegen,
Ja, da muß man kalt und herzlos sein.
Ja, da könnte so viel geschehen,
Ach, da gibt‘s überhaupt nur: Nein
Der erste, der kam, war ein Mann aus Kent,
Der war, wie ein Mann sein soll.
Der zweite hatte drei Schiffe im Hafen,
Und der dritte war nach mir toll.
Und als sie Geld hatten,
Und als sie nett waren,
Und ihr Kragen war auch werktags rein,
Und als sie wußten, was
Sich bei einer Dame schickt
Da sagte ich ihnen: »Nein«.
Da behielt ich meinen Kopf oben,
Und ich blieb ganz allgemein.
Sicher schien der Mond die ganze Nacht,
Sicher war das Boot am Ufer festgemacht,
Aber weiter konnte nichts sein.
Ja, da kann man sich doch nicht nur hinlegen,
Ja, da mußt‘ ich kalt und herzlos sein.
Ja, da könnte doch viel geschehen,
Ach, da gab‘s überhaupt nur: Nein.
Jedoch eines Tags, und der Tag war blau,
Kam einer, der mich nicht bat,
Und er hängte seinen Hut an den Nagel in meiner Kammer,
Und ich wußte nicht, was ich tat.
Und als er kein Geld hatte,
Und als er nicht nett war,
Und sein Kragen war auch am Sonntag nicht rein,
Und als er nicht wußte, was
Sich bei einer Dame schickt,
Zu ihm sagte ich nicht »Nein«
Da behielt ich meinen Kopf nicht oben, / Und ich blieb nicht allgemein. / Ach, es schien der Mond die
ganze Nacht, / Und es ward das Boot am Ufer losgemacht, / Und es konnte gar nicht anders sein.
Ja, da muß man sich doch einfach hinlegen,
Ja, da kann man doch nicht kalt und herzlos sein!
Ja, da mußte so viel geschehen,
Ja, da gab‘s überhaupt kein Nein.
(= Der Barbara-Song; GBA 11,138f.;
Carola Neher in Pabsts Film von 1931)
»Der Song dient im Theaterstück als Pollys Rechtfertigung vor ihren Eltern; auf der dazu gezeigten
Tafel steht: >Durch ein kleines Lied deutet Polly ihren Eltern ihre Verheiratung mit dem Räuber
Macheath an.< Der Titel [des Songs] wird nicht angezeigt; der Name >Barbara< kommt ja weder in
der >Dreigroschenoper< vor, noch wird er überhaupt im Lied erwähnt. Es muß wohl in anderem (noch
unbekanntem) Zusammenhang gestanden haben; da er durch die Aufnahme in das Theaterstück auf-
gehoben ist, ließ Brecht den Titel fallen und beschränkte sich mit der oben genannten Ankündigung
oder wählte den neuen Titel >Der Song vom Nein und Ja<«.
(Fritz Hennenberg: Das große Brecht-Liederbuch. 1984, S. 394)
Notenhandschrift von Franz S. Bruinier mit dem Titel »Barbara Song«; Bruinier zeichnete
handschriftlich für das Arrangement von Brechts Melodien. Titel und die Signierung der Noten
stammen von Brechts Hand. Nach dieser (in der Forschung übersehenen) Überlieferung ent-
stand das vorliegende Dokument 1926 (Mai), eventuell schon Ende 1925, als Bruinier mit den
ersten Arrangements der Brecht’schen Melodien begann. Kurt Weills >Komposition<, die als
neues Arrangement zu qualifizieren ist, beruht auf diesen Vorgaben und ist nicht
selbstständig.
»BARBARA-SONG:
Das
Gedicht
entstand
1927
noch
vor
der
Dreigroschenoper
und
wurde
von
Franz.
S.
Bruinier
mit
einer
Melodie
Brechts
aufgezeichnet
(vgl.
Hennenberg
1984,
S.
374-376).
Der
Name
>Barbara<
hat
keine
inhaltl.
Bedeutung
für
die
Dreigroschenoper
und
ist
nur
durch
die
Übernahme
des
schon
vorhandenen
Gedichts
zu
erklären.
Es
trägt
auch
den
Titel
>Die
Ballade
vom
Nein
und
Ja<
(s.
GBA
11,
S.
342).«
(Bertolt
Brecht:
Die
Dreigroschenoper.
Der
Erstdruck
1928.
Mit
einem
Kommentar
von Joachim Lucchesi. Frankfurt a.M. 2004. SBB 48, S. 165)
Anmerkung:
Nach
dem
Blatt
BBA
249/60
besteht
folgendes
factum
brutum:
Brechts
Melodie
lag
spätestens
1926
vor,
nach
Brechts
üblichem
Verfahren,
die
Lieder
zur
Klampfe
zu
>improvisieren<,
meist
nach
Vorbildern,
arrangiert
und
eventuell
auch
in
Brechts
eigen
-
williger
Notenschrift
(Kreuze)
fixiert.
Brecht
übergab
–
oder
sang
vor
–
Bruinier
seinen
Song,
der
ihn
in
die
professionelle
Notenschrift
übertrug
und
arrangierte.
BB
lernte
Bruinier
im
November
1925
kennen.
Von
da
ab
ist
für
das
Jahresende
sowie
für
das
Frühjahr
1926
eine
erste
intensive
Phase
der
Zusammenarbeit
anzusetzen,
nachgewiesen
mit
dem
»Surabaya-Johnny«,
den
Brecht
im
Frühjahr
1926
in
das
Feuchtwanger-Stück
Kalkutta
4.
Mai
einfügte.
Da
die
»Seeräuber-Jenny«
ähnlich
überliefert
ist
und
nachweislich
zu
Silvester
1926
im
Radio
zu
hören
war
–
gesungen
von
Carola
Neher
–,
dürfte
die
Entstehung
des
»Barbara
Songs«
ebenfalls
für
diese
Zeit
anzusetzen
sein.
Dass
die
Übernahme
des
Songs
in
die
Oper
>nur<
durch
sein
>Vorhandensein<
zu
erklären
sei,
wi
-
derlegt
diese
DigIcone
(Digi+Icone),
die
Sie,
geneigte
Leserin
hoffentlich
gerade
zur
Kenntnis nehmen (wenn nicht, wissen Sie nicht, was Ihnen entgeht).
Hochzeitsszene
in
»Die
3Groschenoper«
(Film
von
G.W.
Pabst,
Tobis
1931):
Polly,
genauer:
Carola
Neher
singt
als
Polly
den
»Barbara-Song«,
nicht
mehr,
um
ihre
Eltern
zu
unterrichten,
sie
habe
einen
Gangster
geheiratet,
sondern
um
an
-
zudeuten,
dass
sie
mit
den
Gangstern
mithalten
kann: die Frau wird >ihren Mann< stehen.
»Der
Barbara-Song]
Entstehung:
Frühjahr
1927
(unabhängig
von
der
Oper).
In
der
Dreigroschenoper
wird
der
Song
als
>ein
kleines
Lied<
bezeichnet,
hat
aber
keinen
Titel.
Polly
rechtfertigt
mit
ihm
ihre
Heirat
mit
Mackie
Messer.
Er
geht
als
Lied
der
Polly
Peachum
in
den
Dreigroschenroman
(Motto
zum
1.
Kapitel)
und
Die
Ballade
vom
Nein
und
Ja
in
die
Ausgabe
der
Songs
von
1949
ein.
Im
Dreigroschenfilm,
Die
Beule,
sollte
er
gegen
die
Seeräuber-Jenny ausgetauscht werden.« (Kommentar, GBA 11,342)
Anmerkung:
Da
die
GBA
aufgrund
von
Sabotage
in
Band
2
=
Stücke
2
falsche
Textgrundlagen
gewählt
sowie
die
Entstehungszeiten
der
beiden
zentralen
Opern
des
20.
Jahrhunderts
vertauscht
hat,
bezieht
sich
der
voranstehende
Kommentar
auf
die
Textgrundlage
der
GBA
(den
»Versuche«-Druck
der
Oper
von
1931),
in
der
der
Titel
des
Songs
getilgt
ist.
Im
Erstdruck
von
1928
ist
der
»Barbara
Song«
mit
Titel
erhalten
und
mar
-
kiert
die
Headline
als
Nr.
9
der
dortigen
Szenenfolge.
Brecht
hat
folglich
den
Namen
>Barbara<
gezielt
eingesetzt.
–
Für
den
Dreigroschenfilm,
als
Treatment
»Die
Beule«
überliefert
(GBA
19,307-320),
strich
Brecht
die
»Seeräuber
Jenny«
ganz
und
rückte
–
da
die
Hochzeit
jetzt
öffentlich
und
als
>gesellschaftliches
Ereignis<
gefeiert
wird
–
den
»Barbara
Song«
an
ihre
Stelle.
In
G.W.
Pabsts
Verfilmung
erhält
–
auf
Drängen
von
Kurt
Weill
–
die
Spelunkenjenny
den
Song
vom
Abwaschmädchen,
das
mit
dem
Lied
seinen
Verrat an seinem >Herrn< kommentiert.
Weill-Handbuch
zum
»Barbara-Song«:
Bruinier
»worked
closely
with
Brecht
between
1925
and
1927.
Among
these
settings
are
versions
of
two
songs
later
used
in
Die
Dreigroschenoper
:
>Seeräuberjenny<
and
the
>Barbara
Song<.
The
latter
need
not
detain
us
here,
as
its
bearing
on
Weill’s
setting
is
insignificant.
>Seeräuberjenny<
is
very
much
more
interesting.
[…]
Certainly
it
is
not
out
of
the
question.
But
until
we
have
further
evidence,
Dümling’s
conjecture
belong
to
the
same
department
of
quasi-mystical
faith
as
Bentley’s
1961
>Homage<.
In
his
excitement
at
the
discovery
of
Brecht-Bruinier,
Dümling
seems
to
have
lost
his
crip
on
musical
and
other
facts.
For
what
is
both
>as
-
tonishing<
and
>celebrated<
is
not
Brecht’s
serviceable
but
in
itself
unremarkable
idea;
it
is
Weill’s
composition
of
it.
Bruinier
may
have
been
the
first
musican
to
board
Brecht’s
Schiff
mit
acht
Segeln<
but
it
was
Weill
who
took
it
to
sea
and
steered
it
to
its
destination
with
all
its
cannon
blazing.«
(David
Drew: Kurt Weill: A Handbook. Berkeley, Los Angeles 1987, S. 202f.)
Lotte
Lenja
und
Rudolf
Forster
in
Pabsts
Film
von
1931,
Hurenhaus
von
Turnbridge,
kurz
vor
Jennys
Verrat,
den
sie
mit
der
Seeräuber-Jenny
einleitet
und
begründet.
Es ist >sein< Donnerstag.
Matthäus
26,47ff.:
»Und
als
er
noch
redete,
siehe,
da
kam
Judas,
einer
von
den
Zwölfen,
und
mit
ihm
eine
große
Schar
mit
Schwertern
und
mit
Stangen,
von
den
Hohenpriestern
und
Ältesten
des
Volkes.
Und
der
Verräter
hatte
ihnen
ein
Zeichen
genannt
und
gesagt:
Welchen
ich
küssen
werde,
der
ist's;
den
er
-
greift.
Und
alsbald
trat
er
zu
Jesus
und
sprach:
Sei gegrüßt, Rabbi!, und küsste ihn.«
Anmerkung:
David
Drew
referiert
Forschungs-Ergebnisse,
die
Albrecht
Dümling
1985
in
seinem
Buch
»Laßt
euch
nicht
verführen.
Brecht
und
die
Musik«
vorlegte.
Drews
Bewertungen
fallen
für
ein
Handbuch,
das
sachlich
zu
informieren
hat,
auffällig
ausfallend
aus.
Dümling
nahm
u.a.
2017
im
»Dreigroschenheft«
(3/2017,
S.
13-28)
Stellung:
»Obwohl
die
Refrain-Melodie
der
Seeräuber-Jenny
tatsächlich
erst
in
Weills
Fassung
berühmt
wurde,
ist
Brechts
musikalische
Idee
zum
Refrain
keineswegs
unscheinbar.
Um
sie
als
un
-
scheinbar
erscheinen
zu
lassen,
verwies
Drew
auf
ähnliche
Intervalle
im
Lied
Poljuschko
Pole
des
Sowjet-Komponisten
Lew
Knipper,
das
Weill
1943
bearbeitet
hatte.
Da
dieses
Lied
aber
erst
1933
entstand,
mutmaßte
Drew:
Unzählige
Parallelen
könnten
zweifellos
in
der
russischen
Folklore
vor
und
einschließlich
der
Zeit
der
Oktoberrevolution
gefunden
werden.
Demnach
hätte
Brecht
für
seinen
Refrain
zur
Seeräuber-Jenny
lediglich
gängige
Formeln
übernommen.«
Dümling
entdeckte
im
Nachlass
die
Unterlagen
zu
»Larifari«
(Berliner
Funk-Stunde
am
31.12.1926),
was
im
Fall
der
Seeräuber-Jenny
den
faktischen
Nachweis
erbrachte,
dass
Carola
Neher
den
Song
nach
Brechts
Melodie
und
Bruiners
Arrangement
im
Radio
sang.
Weill
rezensierte
die
Sendung
und
lobte
Nehers
Vortrag
als
>vorzüglich<.
Der
Weill-Forschung
gelang
es,
diese
Kritik
Weills
in
der
Ausgabe
seiner
Schriften
in
einer
Fußnote
zu
verstecken
und
so
zu
vermeiden,
dass
Carola
Neher
im
Namenverzeichnis
auftauchte.
Rückblickend
erweisen
sich
Drews
Aus-Lassungen
(>quasi-
mystical
faith<),
nämlich
all
der
Anteile
Brechts
und
Bruiniers
an
der
Musik
vor
Weill,
als
bewusste
Fälschungen,
die
schließlich
auch
noch
in
die
Große
Brecht-Ausgabe
eingingen.
Der
Suhrkamp
Verlag
weigert
sich
bis
heute
(10.02.2021),
diesen
Fakten
zu
folgen
und
die
Fehler in der GBA richtigzustellen.
Michael
Morley
zum
»Alabama-Song«,
referiert
von
Albrecht
Dümling:
Erst
kürzlich
stieß
der
Autor
auf
Michael
Morleys
bereits
1982
veröffentlichten
Beitrag
über
frühe
Lieder
von
Brecht
und
Weill.
Nach
genauer
Betrachtung
der
Mappe
249
im
Brecht-Archiv
war
dieser
australische
Brecht-
und
Weill-Forscher
hinsichtlich
des
Alabama-Songs
zum
Ergebnis
gekommen,
dass
Brechts
Rolle
bei
der
Notation
der
Melodie
bedeutsamer
war
als
Weill
ihm
zugestehen
wollte.
Über
die
Melodie
zur
Seeräuber-Jenny
schrieb
Morley,
wesentlich
für
ihre
eindringlich
gespenstische
und
bedrohliche
Stimmung
sei
der
Wechsel
von
den
drängenden
Staccato-Vierteln
und
Achteln
der
Strophen
zum
ly
-
risch
fließenden
Refrain
mit
seinen
weiträumigen
Intervallen.
Aber
es
ist
eben
diese
Struktur
von
Spannung
und
Entspannung,
der
Gegensatz
von
Bewegung
und
nachhallender
Stille,
der
sich
schon
in
Brechts
ursprünglicher
Komposition
findet.
Angesichts
der
melodischen
Begabung,
für
die
Weill
so
gerühmt
wurde,
überrasche
es
umso
mehr,
dass
der
Refrain,
den
man
so
lange
für
eine
von
Weills
inspiriertesten
Eingebungen
hielt,
nun
als
ganz
eigene
Schöpfung
Brechts
erscheint.«
(Dreigroschenheft
3/2017,
S.
28)
Da
sich
der
Barbara-Song
ebenfalls
in
dieser
Mappe
befindet
(BBA
249/60
–
bisher
übersehen?)
und
identische
Überlieferungsmerkmale
aufweist,
gilt
das
Gesagte
auch
für dieses Lied.
Die
Balladen
von
Bertold
Brecht,
die
durch
eine
Verkettung
sonderbarer
Zufälle
seit
Jahren
einzeln
bekannt
und
teilweise
populär
geworden
sind,
ohne
in
Buchform
zu
erscheinen,
sind
jetzt
in
>Bertold
Brechts
Hauspostille<
vereinigt,
die
der
Propyläen-Verlag
zugleich
mit
zwei
Theaterstücken
Brechts
eben
heraus
-
bringt.
Die
Postille
umfaßt
>Bittgänge<,
>Exerzitien<,
die
>Kleinen
Tagzeiten
der
Abgestorbenen<
und
andere
Kapitel
—
Moritaten
mit
Musik,
Chroniken
von
der
Sonderbarkeit,
Armseligkeit,
Abenteuerlichkeit
und
Lust
des
Lebens,
singbare
Refrains,
vollgewichtige
Strophen.
(Der
Querschnitt,
Band
7,
Heft
3,
März
1927,
S. 220)
Die Schlammgeborenen und ihre Choräle
»Wenn
unsere
Väter
ins
Kabarett
gingen,
so
geschah
es
mit
dem
dumpfen
Gefühl
der
Lasterhaftigkeit,
des
intellektuellen
Seitensprungs.
Sie
kamen
sich
vermutlich
sehr
erwachsen
vor,
wenn
die
Barrison-Sisters
ihre
Beine
bis
zum
Knie
entblößten,
wenn
für
ihre
Begriffe
unanständige
Couplets
gesungen
wurden
[…].
Das
damalige
Kabarett
war
sich
seiner
unterirdischen
Funktionen
sehr
genau
bewußt.
Es
sah
sich
selbst
als
die
Kehrseite
einer
Welt,
nach
der
es
insgeheim
Verlangen
trug,
und
die
ihm
doch
für
immer
unerreichbar
blieb.
Bürgerliche
Solidität
war
der
Wunschtraum
aller
dieser
Chansonetten,
der
latente
Refrain
ihrer
Lieder.
Höchst
moralische
Begriffe
wie
Liebe,
Sehnsucht,
Heimat
und
Heirat
bildeten
das
Grundmaterial,
aus
dem
auch
die
laszivsten
Texte
kon
-
struiert waren.
║Die Phalanx der BARBARA’s: Marlene Dietrich (Typ 2) ║ Lotte Lenja (Typ 2) ║ Margo Lion (Typ 2) ║ Kiki (Typ 2) ║ Carola Neher (Typ 3)║
[…]
Noch
das
Freudenhaus
wurde,
nach
der
Nächte
Müh
und
Last,
ein
zärtliches
Home
sweethome,
wo
die
unzüchtige
Hausfrau
Strümpfe
wusch
und
trocknete.
Der
Typus
der
sehnsüchtigen
Dirne,
der
es
nicht
an
der
Wiege
gesungen
war,
und
ihr
Gegenspieler,
der
rettende,
erlösende
Mann
mit
der
wahren
Liebe
beherrschte
die
einschlägige
Literatur.
[…]
Aus.
Vorbei.
Die
ethischen
Krücken,
wurm
-
stichig
schon
seit
geraumer
Zeit,
sind
endgültig
zerfallen.
[…]
In
einer
sozial
aus
den
Fugen
geratenen
Welt
ist
für
moralische
Nachdenklichkeiten
kein
Raum.
Die
Schlagzeilen
des
Mittagblatts
sind
wichtiger
als
die
leeren
Drohungen
derApokalypse.
Die
sen
-
timentale
Kokotte
ist
per
Holzklasse
in
die
Hölle gefahren, wie sie’s verdient.
Und
aus
dem
Schlamm
ward,
mit
leichter
Variation
des
mythischen
Sachverhalts,
die
neue
Venus
vulgivaga
geboren,
griechisch
Pandemos,
berlinisch
Nutte
genannt.
An
die
-
sem
Typus
scheitern
alle
Versuche
der
morali
-
schen
Klassifizierung,
weil
ihm
jede
derartige
Voraussetzung
fehlt,
selbst
die
der
Negation.
Die
Nutte
in
ihrer
reinsten
Form
sehnt
sich
nicht;
bürgerliche
Welt,
Moral,
Gott
sind
ihr
unbekannte
Begriffe,
und
selbst
das
Geld
spielt
bei
ihr
eine
Rolle
zweiten
Ranges.
Sie
ist
die
real
gewordene
Geschlechtlichkeit.
Sie
wurde
ordinär,
nicht
aus
Opposition
gegen
ein
anderes
Frauenideal,
sondern
aus
Zwang,
weil
die
Gemeinheit
ihr
Selbstzweck
ist, weil sie nichts anderes kennt.
Inzwischen
hat
Berlin
den
Typus
kultiviert.
Hier,
wo
der
Zerfall
der
Gesellschaftsmoral
sich
am
hand
-
greiflichsten
vollzieht,
ist
die
geistige
Basis,
ist
auch
das
Frauenmaterial
zur
Ausbildung
des
Nuttenkults
gegeben.
1928
haben
Bert
Brecht
und
Kurt
Weill
die
erste
Fassung
von
>Mahagonny<
an
die
Oeffentlichkeit
gebracht,
ein
Bühnen-Werk,
das
die
sozial-anarchischen
Voraussetzungen
dieses
neuen
künstlerischen
Standpunktes
auf
grundlegende
Weise
zur
Anwendung
bringt.
Kurze
Zeit
darauf
ist
die
>Dreigroschenoper<da,
aus
den
gleichen
Elementen
gebaut
und
als
erstes
Kunstwerk
der
Gattung
erfolgreich.
(Hans
Heinz
Stuckenschmidt:
So
wird
heute
gesungen.
Choräle
aus
dem
Schlamm.
Eine
Feststellung. In Uhu, Jg. 6, 1929/30, Heft 9, Juni 1929, S. 44-48)
Sport im Bild. Das Blatt der guten Gesellschaft. Berlin, Wien, Heft 1, 7. Januar 1927, S. 18
Bert(olt)
Brechts
Erzählung
»Barbara.
Eine
kleine
Autogeschichte«
erschien
in
einer
Illustrierten,
in
der
sie
niemand
vermutet
hatte,
einem
Blatt
nicht
einfach
der
>guten<,
sondern
der
überaus
betuch
-
ten
Gesellschaft.
Diese
interessierte
sich
ausschließlich
für
Autos,
Golfspielen,
Mode,
für
verwöhnte
kleine
Schnucki-Girls
der
Berliner
und
Wiener
High
Society,
für
Eishockey
im
Berliner
Sportpalast
und
für
Reisen,
Reisen,
Reisen,
Reisen
–
sowie
für
Reklame:
Reklame
auf
fast
jeder
Seite.
Die
Geburt
der
Venus
vulgivaga
erfolgte
parallel
zum
Aufschwung
der
viereckigen
Droschke
mit
Pferdestärken
unter
dem
Deckel,
den
man
vornehm
Haube
,
nannte,
weil
ihr
Besitz
anzeigte:
Die
Natur
ist
in
kultivierte
Ordnung,
das
hießt:
unter
die
Haube
gebracht
(da
befindet
sich
der
Motor).
Entsprechend
passten
sich
die
Formen
an
–
und
wehe,
wer
da
an
Sex
denkt
–
womöglich
ungebändigten.
Unter
der/die
Haube sieht man nicht.
Mann
in
Form,
besser:
Unform,
kommt
in
Fahrt,
wenn
Barbara
mit
dem
Kabarettdirektor
einen
>Termin< hat: Auto+Sex=das neue Thema.
Diese Barbara heißt nicht Jenny / Die Räuber fahren noch in Postkutschen
»Die Dreigroschenoper« hat drei
Jennys. Nur eine davon ist Figur
(Person) des Stücks, die Hure Jenny,
genannt die >Spelunkenjenny<. Die
beiden weiteren Jenny‘s gibt es nur in
den Liedern: die Jenny Towler (Typ 1)
und die Seeräuber-Jenny (Typ 2). Von
Jenny Towler, genauer von ihrer
Leiche, singt der Leierkastenmann, der
Moritatensänger:
Jenny Towler ward gefunden
Mit ‘nem Messer in der Brust
Und am Kai geht Mackie Messer
Der von allem nichts gewußt.
Anita Berber (1928)
Nach
dem
Beinamen
des
>Helden<
sowie
der
Tatsache,
dass
der
Haifisch
seine
gefährlichen
Zähne
offen
trägt,
das
Mordinstrument
des
Räubers
jedoch
verborgen
bleibt,
handelt
es
sich
um
eines
der
Opfer
der
Bande,
im
Stück
die
>Platte<
genannt.
Diese
Jenny
erhält
keine
Geschichte.
Sie
bleibt
an
-
onym.
Sie
gehört
zu
denen,
die
im
Dunkeln
hausen,
und
die
man
nicht
sieht
und
die
kein
Gesicht
hat.
Sie
ist
nur
eines
der
Opfer
der
räuberischen
Verhältnisse,
deren
Namen,
Jenny
Towler
,
die
Polizei
zwar noch verzeichnet, nach der kein Hahn mehr kräht, auch nie gekräht hat.
Die
Seeräuber-Jenny
ist
der
Name
des
Abwaschmädchens
in
der
Fiktion
ihres
Lieds.
Sie
singt
es
als
>Verheißung<
einer
–
durch
sie
subversiv
vorbereiteten
–
Apokalypse
der
herrschenden
Gesellschaft.
Für
deren
Ende
steht,
so
jedenfalls
verstand
der
Philosoph
Ernst
Bloch
den
Song,
das
schneidend-
fröhliche
>Hoppla<
,
mit
dem
diese
Jenny
die
Köpfe
der
Macht
rollen
lässt,
und
zwar:
Alle!
Die
Jenny
verkörpert,
so
weiterhin
Bloch
(1929),
das
»Unterirdische
des
Weibs,
sein
geheimes
Einverständnis
mit
der
Unterwühlung«.
Sie
gehöre,
so
immer
noch
Bloch
in
seiner
Eloge,
gewidmet
Lotte
Lenja
und
Kurt
Weill,
zu
den
»Hexen,
vor
denen
die
gesamte
Christenheit
zitterte,
ja
zum
Rebellensymbol
der
Paradiesschlange,
mit
der
sich
Eva
so
gut
versteht«.
Nun
gut,
das
reicht.
Diese
Barbara,
fremd
den
Herren,
unberechenbar,
der
Drachen
am
Herd,
die
Fregatte
im
Garten,
die
Kanaille
in
der
Gesellschaft,
das
Püppilein
unter
Männern,
erwartet
jedoch
immer
noch
den
Erlöser,
den
Mann
»aus
der
völligen
Fremde,
aus
Übersee«,
so
schon
wieder
Bloch,
den
»Rächer,
Entführer,
Schiffs-Messias
dereinst«.
Nein,
auch
mit
dieser
Barbara
wird
sich
nichts
Grundlegendes
ändern,
eine
weitere,
vor
allem
in
Deutschland
erlogene
>Revolution<,
und
die
HERRschaft
geht
weiter,
auch
wenn
Frauen
sie
nun übernehmen oder schon übernommen haben.
Ihr
heutiges
FORMAT
tauchte
einmal
kurz
im
öffentlich-rechtlichen
Fersehen
auf,
im
TATORT
»HARDCORE«
von
2017,
den
die
ARD
–
es
gab
natürlich
öffentlichen
Protest,
vor
allem
von
Frauen,
die diese BARBARAs noch nicht kannten – aus ihrer Mediathek verbannte.
»In
den
knapp
88
Minuten
Spielzeit
von
>Hardcore<
werden
viel
nackte
Haut
gezeigt
und
auch
sexuelle
Handlungen
nicht
tabui
-
siert.
Sehr
klar
ist
außerdem
die
Sprache
dieses
Tatorts:
es
wird
gevögelt,
gefickt,
gewichst,
Darstellerinnen
werden
als
Fotzen
bezeichnet.
Cumshots
und
Bukkake,
DP
und
ATM
sind
in
der
Pornobranche
geläufige
Vokabeln
,
die
sich
Franz
und
Ivo
[die
Ermittler]
erst
einmal
aneignen
müssen,
um
die
Befragungen
der im Fall Beteiligten angemessen durchführen zu können.
Der
Krimi
behandelt
neben
der
Aufklärung
des
Mordfalls
die
per
-
sönlichen
Geschichten
der
Porno-Produzenten,
die
zuletzt
in
den
70er
und
80er
Jahren
tatsächlich
gutes
Geld
mit
ihren
>Schmuddelfilmen<
verdienten,
und
heute
nicht
wissen,
wie
sie
damit
die
nächste
Miete
bezahlen
sol
-
len.
Der
Internetboom
setzte
der
Branche
ordentlich
zu.
Ähnlich
ergeht
es
den
Porno-Sternchen
und
Laiendarstellern,
die
eher
aus
eigener
Lust
und
Neigung
heraus
vor
der
Kamera
agieren,
als
aus
rein
wirtschaftlichem
Denken:
hauptberuflich
arbeiten
sie
alle
in
konventionellen
Berufen;
sie
sind
häufig
im
Mittelstand
zu
finden
–
konsumiert
werden
Pornos
übrigens
durch
alle
Gesellschaftsschichten
hin
-
durch.
Es
sind
Lehrer,
Pädagogen,
Pfleger,
Apotheker,
die
ihre
Bedürfnisse
vor
der
Kamera
ausleben:
meist
alles
Amateure.
Sie
leben
immer
mit
der
Gefahr,
erkannt
zu
werden,
sie
riskieren
dabei
ihr
ge
-
sellschaftliches
Ansehen,
ihre
Reputation,
ihren
Job.
Für
den
Kick,
selten
für
das
Geld.«
(
https://tatort-
fans.de/tatort-folge-1030-hardcore/
)
Dies
ist
ein
Auszug
aus
einer
Darstellung
des
offiziellen
Fan-Clubs,
die
aus
der
ermordeten
>Heldin<
ein
»Porno-Sternchen«
macht
und
ansonsten
mutig
auf
die
verlogene
Doppelmoral
der
Gesellschaft
mit
ihrem
erhobenen
Dödel
zeigt,
der
aber
–
wie
eine
Zuschauerin
schamlos
bemerkt
–
im
Gegensatz
zum
penetrierten
Frauenfleisch
im
Film
nicht
zu
sehen
war,
obwohl
er
doch
>eigentlich<
die
Hauptrolle
spielte.
Nein,
diese
Eva
wollte
einfach
nur
–
wie
es
offen
heißt
–
vögeln,
ficken,
wichsen
(wie
die
Männer)
–
und
findet
in
unserer
formierten
Gesellschaft
dafür
nur
die
>Swinger<-Clubs.
Und
das
Schlimmste:
sie
will
nicht
davon
lassen.
Der
Ordnung
halber
bringt
der
Mann
sie
um.
Das
war’s
schon:
Barbara
Typ
2.
Da
ändert
sich
nix.
Fotze
bleibt
Fotze,
übrigens
der
Lieblingsausdruck
–
auch
in
den
offiziellen
Krimis
von
ARD
und
ZDF
(2019/20/21
Dutzende
Male
gezählt,
z.
B.
Polizeiruf
110: Monstermutter am 31.01.2021, ARD) –
von
Frauen
für
Frauen.
Parallel
dazu
steht
die
Spelunkenjenny
.
Sie
scheint
eine
ganze
Stufe
weiter
zu
sein.
Sie
ist
die
emanzipierte
Nutte,
die
weiß,
wie
frau
mit
den
>Kunden<
umzugehen
hat.
Wenn
sie
die
Männer
nicht
sexuell
vorführt
–
sie
kennt
dieses
Geschäft
und
seine
bürgerlichen
Gewohnheiten
–
greift
sie
zum
üblichen
Mittel,
und
das
ist
der
Verrat.
Sie
verfügt
über
die
>List
des
Weibes<
und
wird
zum
Judas
an
ihrem
>Herrn<;
denn
auch
ihr
Name
fängt
mit
>J<
an,
und
dies
alles
geschieht
auf
dem
Hintergrund
der
Passion
Christi
(Donnerstag:
Verrat
–
Freitag:
Hinrichtung;
Westminster
schlägt
dreimal
die
Glocke,
und
Gott=Königin
rettet
ihren
>Sohn<).
Aber
auch
hier
bestätigt
der
Ausgang
die
Regel
der
räuberischen
Gesellschaft,
die
sich
anschickt
aus
dem
Schlamm
der
Gossen
in
die
gelackten
Bankhäuser
der
City
zu
wechseln.
Das
Verbrechen
veredelt
sich,
ändert
aber nichts an den gesellschaftlichen Verhältnissen.
Kommt
also
noch
die
Polly,
Typ
3,
und
die
heißt
nicht
Jenny
und
nicht
Barbara
–
aber
sie
ist
immerhin
die
Andeutung
(nicht
die
Ausführung)
der
Barbarischen
,
der
Fremden,
die
eben
deshalb
jeder
Beschreibung
spot
-
tet und wie ihr Vorbild Iphigenie (Goethe) eigene Wege geht.
Polly
gewinnt
ihre
schillernde
>Identität<
über
ihren
Song,
den
der
Seeräuber-Jenny.
Da
diese
aber
an
der
Schwelle
des
Übergangs
von
Droschke
und
Auto
–
oder
nach
der
Ökonomie
formuliert:
des
Übergangs
der
Räuberei
zum
seriösen
Bankgeschäft
oder
vom
ge
-
meinen
Mord
zum
Organisierten
Verbrechen
–
steht,
klinkt
sich
sie
aus
der
Reihe
der
Elsas,
der
Nonnen
Schuberts
oder
eben
jener
Sentas
aus,
die
den
Mann
erlöst,
um
an
seiner
Seite
in
den
Himmel
der
Patriarchen
aufzusteigen.
Aber
da
blieben
wir
bei
Wagners
»Fliegendem
Holländer«.
Mitten
im
19.
Jahrhundert,
im
Jahrhundert,
das
die
Deutschen
so
lieben,
weil
sie
in
der
Kunst
ein
wenig
Muse
von
der
Technik
benötigen.
Der
Bayreuther
Brunst-Hügel
winkt.
Diese
Barbara
bleibt
den
Männern
fremd,
die
Gesellschaft aber nähret sie doch. Wer wen?
Ungeübter
Blick
sieht
in
der
Polly
das
junge
naive
Mädchen,
das
sich
so
langsam,
aber
unsicher
in
die
Rolle
der
Räuberbraut
und
schließlich
in
die
der
Platte-HäuptlingIn
HINEIN-ENTWICKELT.
Die
Oper
lässt
jedoch
keine
Zweifel
aufkommen,
dass
Polly
längst
im
Schlamm
der
Gosse
des
Herrn
Vaters,
des
Königs
der
Sümpfe
pfuhlt,
ehe
sie
durch
ihren
>Captn<
dessen
leibhaftigen
Duft
ins
trop
-
fende Möschen getrieben bekommt.
Gemäß
der
Tatsache
–
das
sind
Ergebnisse
der
Soziologie
–,
dass
in
der
bürgerlichen
Geldgesellschaft
die
Frauen
nicht
mehr
offen
als
Unteranin
des
Herren,
hinter
ihm
mit
den
Kinderchen
trottelnd,
vorgeführt,
vielmehr,
ob
sie
auf
Zeit
(im
Puff)
oder
auf
Lebenszeit
(in
der
Ehe),
gekauft
ist,
muss
die
Tochter
auf
ihren
künftigen
Beruf
(als
Geschäftsfrau)
vorbereitet
werden.
Dies
geschieht
–
die
Frau
bleibt
Objekt
der
Herrschaft
–
durch
Prostitution.
Und
die
erlernt
das
brave
Pollylein
zu
Hause,
in
einem
Haushalt,
in
dem
die
untervögelte
Mutter
säuft
und
der
sado-masochistische
Vater
sich
am
Elend
dadurch
ergötzt,
dass
er
den
Sumpf
der
Drury
Lane
und
an
-
derer
Feuchtalleen
mit
duftenden
bun
-
ten
Blüten
dekoriert
dem
läufigen
Töchterlein
das
Nachthemd
im
Bad
verordnet,
damit
es
seine
sanfte
Haut
(und
anderes)
nicht
zu
sehen
bekommt.
»Erst
behängt
man
sie
hinten
und
vorn
mit
Kleidern
und
Hüten
und
Handschuhen
und
Sonnenschirmen,
und
wenn
sie
soviel
gekostet
hat
wie
ein
Segelschiff,
dann
wirft
sie
sich
selber
auf
den
Mist
wie
eine
faule
Gurke.«
Das
weiß
Frau
Mama
über
ihre
Kleine
zu
berichten.
Der
alte
Sack
hält
mit:
»Celia,
du
schmeißt
mit
deiner
Tochter
um
dich,
als
ob
ich
Millionär
wäre!
Sie
soll
wohl
heiraten?
Glaubst
du
denn,
daß
unser
Drecksladen
noch
eine
Woche
lang
geht,
wenn
dieses
Geschmeiß
von
Kundschaft
nur
unsere
Beine
zu
Gesicht
bekommt?
Ein
Bräutigam!
Der
hätte uns doch sofort in den Klauen!«
Genau
an
dieser
Stelle
steht
–
durchaus
in
erkennbarem
Zusammenhang
und
als
inhaltliches
Signal
–
der
»Barbara-Song«.
Polly
deutet
damit
nicht
nur
>ihre<
Heirat
an,
mit
der
sie
die
Konsequenz
aus
ihrer
Erziehung
zieht,
sondern
auch,
dass
sie,
wenn
schon
denn
schon,
ihren
Verkauf
selbst
organi
-
siert,
also
aus
dieser
Herrschaft
(Typ
1)
aussteigt
und
den
>Bräutigam<
selber
wählt.
Diese
Barbara
demonstriert
ihren
korrupten
Eltern,
dass
sie
durchschaut
sind,
dass
ihnen
ihr
Töchterlein
fremd
ge
-
blieben ist und dass diese sich aus der ihr zugedachten Rolle als zukünfigte Ehenutte befreien wird.
Die
Befreiung
erhält
zum
Zeitpunkt,
als
der
Mann,
hier
der
stolze
Räuberchef
Mac,
seinerseits
wähnt,
die
Frau,
Polly,
auf
Lebenszeit
gekauft
zu
haben,
einen
neuen
Akzent.
Polly
verwandelt
die
–
mühsam
aufgebaute
Szenerie
der
Hochzeit
–
virtuell
in
einen
Sumpf
und
siedelt
inmitten
des
gerade
gegründe
-
ten
(scheinbar)
bürgerlichen
Haushalts
die
Umstürzlerin
an.
Von
dieser
Jenny
erfahren
wir
nichts,
außer,
dass
sie
über
verschiedene
Formate
der
Realität
verfügt:
über
die
Szenerie
der
bürgerlichen
Wohlanständigkeit,
über
die
der
bürgerlichen
Geselligkeit,
über
die
des
realen
Sumpfs
der
Gesichtsrosen,
die
nie
auf
Rosen
gebettet
waren,
und
über
eine
Möglichkeit,
diesem
ganzen
Theater
die
Bretter
unten
den
Füßen
wegzuschlagen.
Ansonsten
bleibt
sie
fremd.
Sie
folgt
keinem
Herrn
mehr,
sie
entflieht
auf
wankendem
Boden
–
wohin?
Es
gibt
keine
reale
Utopie,
die
deshalb
auch
so
heißt,
nämlich
Nicht-Ort.
Es
gibt
nur
Aussicht
auf
Veränderung.
Die
jedoch
–
so
die
Andeutung
und
so das Verhalten der Polly im Spiel – wartet auf keinen Messias mehr. Deshalb heißt sie Barbara.
Eine
weitere
Andeutung
jedoch
will
ich
nicht
verschweigen.
Im
anschließenden
>Gespräch<,
genauer
in
der
Theater-Kritik
der
Platte
und
Macs
–
denn
Theater
hatte
Polly
ja
gespielt
mit
ihrem
Song
–,
fügt
sich der Offenheit der >Lösung< noch ein Aspekt an:
MATTHIAS Sehr nett, ulkig, was? Wie die das so hinlegt, die gnädige Frau!
MAC Was heißt das, nett? Das ist doch nicht nett, du Idiot! Das ist doch
Kunst und nicht nett. Das hast du großartig gemacht, Polly. Aber vor sol-
chen Dreckhaufen, entschuldigen Sie, Hochwürden, hat das ja gar keinen
Zweck. Leise zu Polly: Übrigens, ich mag das gar nicht bei dir, diese
Verstellerei, laß das gefälligst in Zukunft.
Die
Veränderung
benötigt
Verstellen,
das
Verrücken,
das
Wechseln
der
Ebenen,
das
Aufdecken
von
Schein
und
Sein,
sie
braucht
Ver-Fremdung,
und
die
kommt
–
wer
hätte
das
gedacht?
–
von
den
Barbarischen,
den
fremden
Frauen,
von
denen
wir
nur
eines
wissen,
dass
sie
nicht
mehr
den
Männern
Paroli
bieten
wollen,
mit
ihnen
gleichziehen
(was
ist
Gleichberechtigung?),
sie
>gar<
über
-
treffen
wollen,
sondern
für
veränderte,
für
grundlegend
veränderte
Verhältnisse
sorgen
werden.
Wie
sie aussehen? Wer weiß?
Kurz: Barbara ist die kunstreiche und lustvolle weibliche Inkarnation des ästhetischen
Prinzips der Ver-Fremdung.
Die profane Legende der unheiligen Barbara (authentisch um 300 nach Christus)
Und
es
begab
sich,
dass
die
kluge
und
wunderschöne
Tochter
des
reichen
Unternehmers,
der
sich
Dioscuros,
Sohn
des
Zeus,
nannte,
ihrem
Vater
den
Gehorsam
verweigerte.
Sie
wollte
weder
seinem
Geschäft
dienen,
noch
wollte
sie
auf
den
Bräutigam
warten,
den
ihr
Göttervater
schon
vor
ihrer
holden
Geburt
für
sie
ausgesucht
hatte:
gelackt,
von
schimmernder
Haut,
nach
allen
Parfümen
des
Orients
damp
-
fend,
schön
wie
die
Statue
des
Narziss,
hohl
im
Kopf
und
ausgestattet
mit
einem
ausgesucht
kleinen
Pimmel.
Diesen
hatte
sie
einst,
als
der
Jüngling
sich
zum
Bade
begab
im
nahen
Golf
von
İzmit,
unbemerkt
erspäht
und
beschlossen,
der
kommt
mir
nicht
zwischen
meine
fein
-
fleischigen Schenkel.
Da
nehme
ich
lieber
den
miefenden
Fischerburschen
aus
dem
Hafenviertel.
Der
stinkt
wenigstens
in
-
tensiv
nach
dem,
was
er
täglich
an
schwe
-
ren
Weinen
in
sich
hinein
gießt,
und
nach
den
Fischkadavern,
die
er
trantriefend
in
sein
Maul
stopft.
Dessen
Schwengel
sah
sie
schon
von
weitem
die
Pumphosen
füllen.
Da
musst
du
dich
einfach
hinlegen,
sagte
sie
sich.
Der
Vater
jedoch
hütete
sie
für
seine
Nachfolge,
verbot
ihr,
sich
an
ihrer
zarten
Haut
zu
er
-
freuen,
und
hielt
die
sorgende
Mutter
entschieden
an,
das
Kind
nur
im
Nachthemde
zu
baden.
Er
erkannte
ihre
bösartige
Neigung
und
schloss
haarscharf
auf
übersteigerte
sexuelle
Appetenz
–
ja
so
hieß
dies
einst
in
der Fachsprache – und sie im Turm des Hauses ein.
Als
ihr
Vater
auf
Geschäfte
verreiste,
um
seiner
Appetenz
am
Altar
der
Aphrotitte
zu
huldigen,
juckte
es
sie
unerklärlich.
Darob
kletterte
sie
stracks,
aber
heimlich
aus
dem
Turm
herab,
indem
sie
mit
ei
-
sernem
Griff
das
Fenster
nach
außen
stieß,
eilte
in
den
Hafen
und
warf
sich
zum
Fischer
höschenlos
ins
Traumboot
der
Liebe.
Während
sie
sich
tranvoll
zusangen
>die
Liebe
dau
-
ert
oder
dauert
nicht<,
ließ
sie
unter
weitem
Rocke
ihren
zarten
Mond
herr
-
lich
aufgehen.
Sie
flog
nach
oben,
bald
mit
dem
Steiß,
bald
mit
dem
vorderen
Gesicht.
Der
Wind
tastete
durch
die
Gewänder.
Und
die
künftige
Madonna
mit
dem
weißen
Steiß
lächelte
lieblich
doppelten
Gesichts.
Der
grüne
Mond
droben,
der
freundlich
zusah,
befand:
Das
ist
gut
so
und
kann
vorläufig
so
bleiben.
Der
Vater,
zurückkehrt,
bemerkte
natür
-
lich
den
Schaden
an
seinem
herrschaft
-
lichen
Anwesen
und
erkannte
klar
und
deutlich:
Ich
habe
dieses
Segelboot
nicht
aufgetakelt,
damit
es
sich
als
löchrige
Ruderkiste
unter
den
Brücken
der
Themse
verkrümelt.
Das
ruiniert
mein
Geschäft.
Also
verabreichte
der
Vater
ihr
reichlich
und
täglich
Prügel,
damit
sie
sich
eines
Besseren
besönne.
Doch
eines
Tages
gelang
es
ihr,
sich
mit
Hilfe
des
Burschen
zu
befreien.
Jetzt
musste
das
Gefühl
endgültig und immer auf seine Rechnung kommen. Der Mensch wird ja sonst zum Tier.
Die Liebe dauerte nicht, auch nicht an diesem, schon gar nicht an jenem
Ort. Als der Bursche bemerkte, dass der kleine Teil des Mädchens von İzmit
auch anderen genügen könnte, gönnte er sie auch seinen Genossen, damit
die Gang mit Bang genösse, was er schon satt hatte. Wenn schon teilen,
dann richtig. Außerdem pflegte die nunmehrige Hausfrau am heimischen
Herde undeutlich von einem Schiff mit acht Segeln so penetriert zu flöten,
dass er befand, solch unzüchtige Liedchen gehörten in den Puff und die
Frau dazu. Meer ward mehr bei so viel weiblicher Nässe. Da ertrinkt >man<
auf die Dauer. Besser sie ginge gleich ins Wasser. Die sexuelle Appetenz
hatte sie so weit gebracht.
Zeus
erbarmte
sich
jedoch
seines
Sohns.
Denn
es
erhob
sich
unverhofft
––
ein
freundlicher
Leumund
über
das
Mädchen
aus
İzmit.
Der
Vater
zahlte
für
ihn
ein
Vermögen
an
die
stets
offenen
Hände
(und
Hosen)
der
Priesterkaste,
die
sich
ihren
Ruf
was
kosten
ließ.
Auch
sie
hatten
Aktien
bei
Dioscuros,
den
Göttlichen,
und
deren
Hochs
durften
nicht
auf
absteigendem
Aste
ins
Bodenlose
sinken.
Wo
blieb
sonst
die
Altersversorgung?
Auf
Zeus
selbst,
der
seiner
sexuellen
Appetenz
auf
Europa,
diesmal
wie
-
der als Bulle, an den Quellen des Finanz-Segens nuckelte, war kein Verlass mehr.
Auch
hier
zog
die
Neue
Zeit
ein.
So
ging
die
Kunde,
die
Tugendhafte
von
İzmit
sei
auf
dem
Weg
zum
Bade
im
Golf
von
İzmit
vom
Pfade
abgekommen,
den
Felsen
hinabgestürzt
und
im
Meer
ihrer
eigenen
Nässe
verschwunden.
Da
sich
aber
der
Kirschzweig,
den
sie
als
Zeichen
ihrer
Reinheit
bei
sich
trug,
als
sie
stürzte,
verfing
ihrem
Gewande
und
nach
dem
Sturze
liegen
bleib,
siehe,
da
tränkte
er
sich
aus
dem
Meer
mit
dem
Samen
des
nachhaltigen
Wachstums
und
erblühte
in
voller
Pracht.
Dies
ein
jedes
Jahr
von
neuem.
Dieser
Baum,
genauer
seine
aufblühenden,
wahrlich
imaginativen
Zweige
erinnerten
an
das
schöne
Mädchen
von
İzmit
und
fanden
ihren
heiligen
Platz
im
aufgepflanzten
Turme
der
Herrschaft,
wo
einst
das
züchtige
Mädchen
ihrer
Bestimmung
harrte.
Ihre
arbeitsteilige
Analogie
ging
derweil
der
eingeborenen
(=indigenen)
Berufung
nach.
Der
kleine
Teil
wurde
mit
den
Zeiten
immer
ge
-
nügsamer
und
starb
schließlich
ab
–
und
die
Dame
dazu.
Da
sie
allen
eine
Fremde
blieb,
nannten
sie
sie
Barbara.
Den
Sohn
des
Zeus,
ihren
Vater,
erschlug
der
Blitz,
den
er
seinem
Vater
zum
Erproben
entwendet hatte, aber nicht hantieren konnte. Das hatte er nun davon.
Zu
Ehren
der
Barbara
von
Nikomedia
stellt
man
bis
heute
am
4.
Dezember,
dem
Barbaratag,
ein
paar
Zweige
des
Kirschbaums
in
die
gute
Stube
und
hofft,
dass
sie
bis
zur
Auferstehung
des
Fleisches
in
Blüte
kommen.
Wer
ihren
zarten
Duft
einhaucht,
der
sei,
so
sagt
man,
geschützt
vor
Gewitter,
Feuer,
Pest
und
Fieber
und
plötzlichem
Tod
–
und
schiefen
Legenden,
die
zum
Himmel
stinken.
Quod
erat
demonstandum.
Valeska Gert: Die herrliche Wollust oder Der Vorhang zu und alle Fragen offen
Ich
begehre,
nicht
mehr
zu
leben.
Laß
ab
von
mir,
denn
meine
Tage
sind
eitel.
Was
ist
ein
Mensch,
daß
du
ihn
groß
achtest,
und
bekümmerst
dich
um
ihn?
Du
suchest
ihn
täglich
heim,
und
versuchest
ihn alle Stunde.
Hab
ich
gesündigt,
was
tue
ich
dir
damit,
o
du
Menschenhüter?
Warum
machst
du
mich zum Ziel deiner Anläufe, daß ich mir selber eine Last bin?
Und
warum
vergibst
du
mir
meine
Missetat
nicht
und
nimmst
nicht
weg
meine
Sünde?
Denn
nun
werde
ich
mich
in
die
Erde
legen,
und
wenn
du
mich
morgen
su
-
chest, werde ich nicht da sein. (Das Buch Hiob).
Man
muß
die
Knie
vorwerfen
wie
eine
königliche
Dirne,
als
ob
man
an
Knien
hinge.
Die
sehr
groß
sind.
Und
purpurne
Todesstürze
in
den
nackten
Himmel
und
man
fliegt
nach
oben,
bald
mit
dem
Steiß,
bald
mit
dem
vorderen
Gesicht.
Wir
sind
völlig
nackt,
der
Wind
tastet
durch
die
Gewänder. So wurden wir geboren.
Nie
hört
die
Musik
auf.
Engel
blasen
in
einem
kleinen
Panreigen,
daß
er
fast
platzt.
Man
fliegt
in
den
Himmel,
man
fliegt
über
die
Erde,
Schwester
Luft,
Schwester,
Bruder
Wind!
Die
Zeit
ver
-
geht und nie Musik.
Nachts
um
2
Uhr
werden
die
Schaukeln
geschlossen,
damit
der
liebe
Gott
weiterschaukeln
kann.






















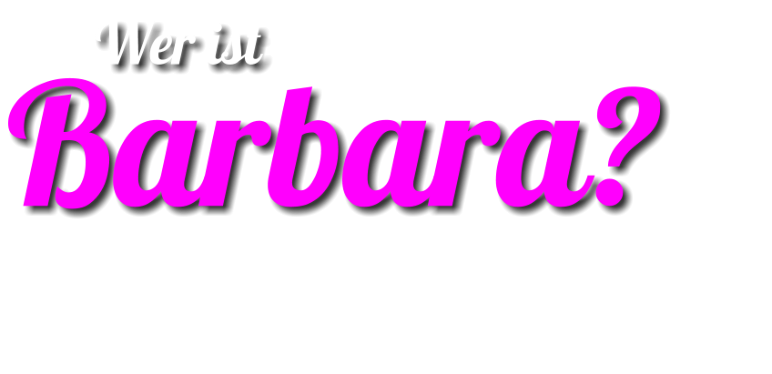

BRECHTLEBTBRECHTIANA 28. September 2021




BRECHTIANA SONG 01
BRECHTIANA Als Dylan Brecht endeckte