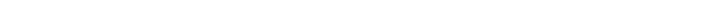Offenbar im Auftrag des Verlags präsentiert sich ein aktualisierter „Mythos Suhrkamp“, und der ist zeitgemäß digital abrufbar bei 3sat (ab 2018 und wurde fortgesetzt in den üblichen Würdigungen zum Jubiläum um den 1. Juli 2020). Natürlich vergisst der Autor des fernsehgerechten „Crossover“ (so die Werbung) nicht den Topos von der Suhrkamp-Kultur, unterschlägt nicht den Kapitalisten Unseld zur Zeit der Studentenrevolte oder den schachspielenden Freund seiner Poeten und lässt dazu einmal mehr die großen Namen aus Dichtung, Theater, Wissenschaft, Philosophie sprudeln. Die „deutsche Misere“ jedoch, die kein anderer Verlag als der des Peter Suhrkamp und seines Nachfolgers Siegfried Unseld widerstrebend vertreten musste, weil die politischen Verhältnisse sie aufzwang, kommt nicht vor. Zu markieren wäre sie gewesen über die eine historische Säule des Verlags Bertolt Brecht – die zweite war Hermann Hesse, Unselds Lieblingsautor.
Für Brecht und sein Werk hat der Film von knapp 90 Minuten ganze acht Sekunden Zeit. Stattdessen lässt er den von der Stasi als „Kulturalibi der BRD“ gebrandmarkten Verleger Unseld in den siebziger Jahren um den Bahnhof Friedrichstraße „herumstreichen“, weil er sich unbedingt ein politisch heikles Stück aus der DDR beschaffen möchte. Die „intensiven Ost-Kontakte“, die das „kulturelle Aushängeschild der BRD“ pflegte, musste die DDR ertragen, weil Unseld die „Westrechte“ an Brecht hatte und seine „Erben zum Teil in der DDR“ lebten“, wie die Stasi-Protokolle zerknirscht festhielten. Die von DDR -Oberen „eigentlich“ konstatierte „Notwendigkeit“, „die Geschäftsbeziehungen zu diesem Verlag einzustellen“, untergrub Unseld mit den (nun so genannten) „Brecht-Weltrechten“ und dem Besitz „der Rechte namhafter Schriftsteller der westlichen Welt“: Die machten den
„Kontakt zu ihm unumgänglich“.
Nichts vom „Jahrhundertunternehmen“ der Großen Brecht-Ausgabe (GBA), nichts von den intensivsten Kontakten mit der DDR während der Jahre 1983-1989 (9. November). Nichts von der direkten Sonderpost Suhrkamp-Aufbau an der Stasi vorbei. Nichts vom sorgsam überwachten Kopiergerät im „Bertolt-Brecht-Archiv“ (BBA), Berlin/Hauptstadt der DDR, dessen jede Kopie von den Brecht-Erben eigenhändig signiert sein musste. Nichts von der Sabotage der DDR-MitarbeiterInnen an der GBA. Nichts vom Vertragsbruch der Brecht-Erben, die Dokumente zurückhielten und die laufenden Arbeiten im BBA hintertrieben. Nichts von den Überwachungsstrategien der Stasi, die immer dabei war und selbst die persönlichsten Gespräche auf der Chausseestraße mithörte. Kein Wort zu und von Unselds Nachfolger, den dieser aus Karlsruhe abwarb, weil er seinen Traum, mit Brecht die Mauer zu überwinden, nur mit einem, der „anpackt“, bewältigen konnte.
Kein Wort zur Digitalisierung, die mit der GBA über den Suhrkamp Verlag in den Staat der Briefeöffner und Fortschrittsverhinderer hineintröpfelte. Nichts von der „kühnsten Lösung“ als der besten, die das „gemeinschaftliche Unternehmen“ für den verantwortlichen Ostverleger Elmar Faber versprach. Auf der Pressekonferenz Ost-West 1985 in der „Hauptstadt“ brach sich die Begeisterung des Aufbau-Verlegers über das wohl größte Projekt der Verlage überhaupt dermaßen Bahn, dass Faber lautstark dessen „Unikalität“ in den Saal des Pressezentrums schmetterte. Unseld schob mir hinter Fabers Rücken einen Zettel zu: „>Unikalität<, gibt es das?“. Ich notierte: „Ab heute! 13.9.85“ und schleuste den Zettel zurück. Und schließlich: nichts von den Rechtsbrüchen der DDR-Gesetze durch die Suhrkamp-Mitarbeiter an der GBA, welche die berüchtigten Vopos vom Bahnhof Friedrichstraße immer mal wieder zur Weißglut auflaufen ließen, die diese aber zähneknirschend ertragen mussten.
Unvergessen bleibt die Szene in der „Tränenhalle“ (Grenzübergang Berlin-Friedrichstraße) an jenem Sonntag im grauen Mond September, dem 15. des Jahres 1985, nach der ersten öffentlichen Präsentation der geplanten GBA. Unseld, seine beiden Herausgeber und der zuständige Lektor Wolfgang Jeske waren vom neuen Kompagnon Aufbau zur Pressekonferenz in die Hauptstadt der DDR mit einem Tagesvisum vom 13. September eingereist, das sie am 15. an der Grenze vorzuzeigen hatten und das bewies: drei Tage illegaler Aufenthalt in der Republik; darauf stand Zuchthaus. Das gab es noch nie. Der Vopo, der als erstes die ungeheuerliche Grenzverletzung wahrnahm, hatte Mühe, seinen ausgerenkten Unterkiefer wieder zum gewohnten Abschreckungsgesicht zusammenzusetzen. Die Halle – Hunderte von Grenzgängern standen in der Schlange – wurde geräumt, und das kleine Häufchen der Westmenschen, offenbar vom Klassenfeind eingeschleust, stand plötzlich allein auf der weiten Flur, wo sonst die Tränen flossen. Die Zuständigkeiten wurden von einem Dienstgrad in den nächst höheren so umständlich wie hektisch geprüft, zunächst sichtbar, dann unsichtbar hinter den braun-grauen Auf- und Abtrittstüren der kollossalen staatlichen Bedürfnishalle mit den gekachelten Wänden. Unsere Freigabe („von ganz oben“) erfolgte noch gerade rechtzeitig. Wir erreichten den Flieger in Tegel.
Auf diesem Hintergrund und aufgrund der Tatsache, dass ohnehin keine ordentliche Feier angesagt ist, werfe ich ein paar Schlaglichter auf den Verlagsgründer und auf wenige seiner Tätigkeiten, die Zeichen setzten. Sie kommen in den bekannten Würdigungen nicht oder nur am Rande vor, sie dokumentieren die wechselvollen Kontinuitäten der deutschen und dann der deutsch-deutschen Geschichte und verbinden sich mit dem Namen Bertolt Brecht und dessen Werk. Erstmals bemerkte dieser Brecht den >jungen, dünnlippigen, kühl-ironisch blickenden Herrn< im Publikum bei einer Lesung des späteren Nazi-Barden Hanns Johst in dessen Haus und stellte fest: „Sie mögen ihn nicht“. Das war am Freitag, dem 9. Juli 1920. Brecht mochte ihn offensichtlich, auch wenn er dies nur sehr gelegentlich durchblicken ließ.
1929 kam Peter Suhrkamp nach Berlin. Brecht hatte den Erfolg der „Dreigroschenoper“ überstanden und schrieb plötzlich ein Hörspiel für den deutschen Rundfunk. Der „Uhu“, das „Neue Magazin des Ullstein-Verlags“, in dessen Redaktion der erfolglose Schriftsteller Peter Suhrkamp Arbeit für seinen Lebensunterhalt fand, publizierte aufwändig und bilderreich den kargen Text des „Lindbergh“, so auch der dürftige Titel des „Heldenlieds“, das den da schon legendären Ozeanflug vom Mai 1927 als scheinbare Live-Doku feierte (das Radio machte es möglich). Die Publikation unterlegte die (noch lesbare) Schrift mit Fotos vom leeren Himmel, in den ein einsamer Flieger einmontiert war, und gab der begeisterten „Menge“ auf dem Pariser Flughafen Le Bourget kein Gesicht, indem sie die Schlussszene mit einem Foto der Arbeiter von Ford in Detroit unterlegte. Brecht hatte das Abbild der am Fließband geschundenen Masse schon für sein Erfolgsstück vor der „Dreigroschenoper“, nämlich „Mann ist Mann“ (1925/26), auf dem Umschlag verwendet. Hier werden Menschen gefügig gemacht, indem man sie wie Autos „am laufenden Band“ funktionsgerecht zusammenmontiert.
Nach dem erfolglosen Versuch auf der „Deutschen Kammermusik Baden-Baden 1929“ mit diesem „Radio-Hörspiel“, jetzt „Der Lindberghflug“ genannt, den Rundfunk über die neue Mode der „Gebrauchsmusik“ zu revolutionieren, verfassten Suhrkamp und Brecht eine Art Manifest, nannten es „Zur Soziologie der Oper“ und publizierten die Schrift 1930 im 4. Heft der „Musikantengilde“. Dies war das Organ der zumindest nationalistisch angehauchten Gemeinschaftsmusiker, die 1927 und 1928 parallel zur Kammermusik ihre Reichsführerwochen abhielten, 1929 sich aber weigerten, weiter mitzumachen, weil ihr (ehemaliger) Mitstreiter Paul Hindemith die „Gemeinschaftsmusik“ in „Gebrauchsmusik“ umgetauft und sich mit Kurt Weill an der Komposition zum „Lindberghflug“ beteiligt hatte. Das war Verrat. Ob nun aus Rache oder Unwissen: die Gilden gaben den beiden Ironikern Platz, die neue Mode hinterhältig zu verspotten. Der Versuch, das Publikum aus seiner passiven Empfängnis herauszulocken durch Mitspielen, schaumgeboren wie einst Aphrodite, sei nichts anderes, als mit Musik vom Laien so Gebrauch zu machen, wie eine Frau „gebraucht“ würde. Der „hörmüde Hörer“ zeigte sich auf einmal spielfreudig, und die gängige „Hörfaulheit“ schlüge um in den „Hörfleiß“ und lande schließlich im „Spielfleiß“.
Was ich hier referiere, ist die ebenfalls von Brecht und Suhrkamp gemeinsam gezeichnete Radiotheorie von 1930, verfasst im Anschluss an den „Lindberghflug“ und anlässlich seiner Publikation als „Flug der Lindberghs“ in den „Versuchen“. Sie führte zur in der Brechtforschung epochemachenden Lehrstück-Theorie des angeblichen Mitspieltheaters (für alle), und sie hat vor allem Furore gemacht, als die späten digitalen Erben von 1968 auf Brechts Forderung von 1930 stießen, der Rundfunk müsse endlich aus dem Distrubutionsapparat in einen Kommunikationsapparat „umfunktioniert“ werden. Das Internet machte es möglich, Brechts „Utopie“ fand Erfüllung, ihm war der eigentliche Ursprung des web 2.0 zu verdanken. Auch Sascha Lobo, der neue Blogger-Guru, hat Brecht inzwischen mit seinem „Web-2.0-Vermächtnis“ in die „digitale Allmende“ eingelassen. Vergessen jedoch wurde Peter Suhrkamp, der zumindest den gleichen Anteil beanspruchen kann. Es war die schaumgeborene Erfindung des „Medien-Rückkanals“ (Lobo), deren sich die beiden nun für immer schmücken dürfen und wovon sie nie eine Ahnung hatten. Aber immerhin. Das Digitale macht alles Mögliche möglich.
Das ging auch „analog“, wie heute das Reale heißt. Im November-Heft 1929 des „Uhu“ – er hatte sich zu Suhrkamps Zeiten auf über 200.000 Exemplare aufgeplustert – trat das Erfinder-Team wieder an, diesmal erweitert um eine Dame, Elisabeth Hauptmann, um den schweren Unfall, den der rasende Brecht in seinem Nobel-Steyr im Mai des Jahres gebaut hatte, geschäftlich auszubeuten. Der Steyr war Schrott, der Fahrer lag (der Öffentlichkeit verschwiegen) im Krankenhaus. Hauptmann-Suhrkamp-Brecht stellten den Unfall mit einem neuen, leicht demolierten Steyr nach, gaben dem Fahrer des Lastwagens, ebenfalls ein Modell der Firma Steyr, die Schuld und ließen, mit „Originalfotos von der Unfallstelle“, den Dichter mit 70 Stundenkilometern gegen einen Baum donnern. Brecht, der Vernünftige, hatte mit Überlegung und Reaktionsschnelligkeit erkannt, dass die lange Motorhaube als Knautschzone den Stoß locker auffinge. Der Raser kam so mit einer läppischen Knieverletzung davon (jedenfalls im „Uhu“, bekannt als Satire-Magazin) und bekam von der österreichschen Waffenfabrik, die mit ihren Autos auf den deutschen Markt drängte, eine neue Kiste geschenkt, dank Peter Suhrkamps Fotomontagen und seiner einfühlsamen Texte und dank Elisabeth Hauptmanns Verhandlungsgeschick mit der Firma Steyr, die vorsichtshalber auf die Rückklappe des (schuldigen) Lastwagens ihr Logo peppte. Reklame war 1929, als in Berlin ihr erster internationaler „Welt-Kongreß“ stattfand, schon alles.
Fehlt noch der „politische Suhrkamp“, nicht der als Jude Verfolgte (er war Deutscher und wurde als unbequemer Deutscher verfolgt), sondern als der Helfer in der Not. Das lief bisher unter: >Suhrkamp hat Brecht am Tag nach dem Reichstagsbrand zur Flucht verholfen<. Frage: Wie kam es, dass Brecht vor dem Reichstagsbrand auf den gepackten Kisten bei einstrahlender Sonne am Schreibtisch saß? Der Brand war frühestens gegen 22 Uhr an jenem 27. Februar, mit dem der Nazi-Terror seine Herrschaft endgültig zu stabilisieren begann, allgemein bekannt. Brecht hatte seine Kinder schon Tage vorher auf die Reise geschickt. Um einer möglichen Verhaftung in der Nacht des Brands zu entgehen, nahm Peter Suhrkamp Brecht und Helene Weigel in seiner Wohnung auf, um sie dann am frühen Morgen in den Zug nach Prag (Richtung Osten, das fiel nicht so auf), mit Ziel Wien, zu setzen. „Einquartierung“ hieß das in früheren Jahrhunderten im Kriegsfall und pflegte für die Betroffenen durchaus kein Vergnügen zu bedeuten. Eine solche „Requirierung“ der privaten Räume leistet man freiwillig nur guten, sehr guten Freunden, und es war Brecht, der diesen Einsatz durch 15 Jahre Exil in sich trug und der gleich in seinem ersten Brief an Suhrkamp nach dem Krieg beteuerte: „Ich habe Ihnen Ihre Hilfe bei meiner Flucht nicht vergessen“.
Viel wichtiger scheint mir, von heute aus gesehen, zu fragen: Wie kam es, dass Suhrkamp und Brecht zumindest ahnten, was in jenen letzten Februartagen des Jahres 1933 bevorstehen könnte? Woher wussten sie, dass in jeder Nacht dieser Tage ein Pogrom drohen konnte, sodass die eigene Wohnung nicht mehr sicher war? Und heute gilt: Wie kommt es, dass maßgebliche Teile der bundesdeutschen Historiographie die Täterschaft der Nazis oder zumindest ihre aktive Beteiligung am Reichstagsbrand noch immer leugnen oder herabspielen im Zuge eines offenbaren Vergangenheitsbewältigungsbewusstseins? Die wahre Elite zeichnet sich dadurch aus, dass sie ihre kritischen Einsichten auch praktisch vertritt und Ignoranz gegen ihre betroffenen Mitmenschen verweigert. Das zeichnete Peter Suhrkamp aus und sollte einem Verlag, der Autoren publiziert und nicht Bücher, vor allem zur Ehre gereichen.
Dem jetzigen Verlagschef Jonathan Landgrebe, der seit Jahren meine Versuche ignoriert, die Arbeit produktiv fortzusetzen, wäre es sicherlich recht, wenn ich zum gegebenen Anlass nicht zu Wort käme. Das aber hieße, den wesentlichen Teil der bisherigen Verlagsgeschichte, den der deutsch-deutschen Zusammenarbeit vor dem 9. November 1989, zu unterschlagen und in Sachen Brecht – das ist das kuriose Ergebnis der Verlagspolitik seit Unselds Tod – die Tendenz zu fördern, dass die DDR zwar untergegangen ist, der DDR-Brecht aber hartnäckig im öffentlichen Bewusstsein weiterlebt. Keiner der Herausgeber der GBA, ob Ost oder West, hat sich 1981, als die ersten Pläne gemacht wurden, danach gedrängelt, 20.000 Seiten Brecht zu edieren: Brecht zu edieren, ist kein Vergnügen, sondern eine Strafe. Darüber waren sich alle Herausgeber angesichts der Brecht-Erben und des Zustands des Brecht-Archivs (Berlin-Ost) von vornherein erstaunlich einig.
Sie waren sich aber auch einig darüber, dass die Möglichkeit, wie Unseld formulierte, „über unsere schwierige Grenze hinweg zu kooperieren“ und damit zu dem beizutragen, „was mit deutscher Kultur zu tun“ hat, wie die „Volksstimme“ (Wien) am 17. September 1985 betonte, und, dass ein „internationaler Autor wie Brecht heute angemessen nur in internationaler Verlagskooperation“ betreut werden könnte. So vertrat ich seit 1983 als wohnhafter Dauergast in der DDR mit einem Sondervisum des Ministerrats der DDR den Suhrkamp Verlag aktiv und hielt somit das „Kulturalibi der BRD“ über zwanzig Jahre lang im geteilten Deutschland mit hoch. Als „Klassenfeind“ verfasste ich im Auftrag des Henschel Verlags ein Buch über Dürrenmatt (1986), schrieb in DDR-Zeitungen und trat im Rundfunk (DDR 2) auf, ging in der maßgeblichen DDR-Kultur-Szene ein und aus (bei Bunges, bei Hechts und Mühls, bei Heiner Müller, Volker Braun, Elmar Faber, Horst Wandrey, im BE), hatte als VIP Einlass in die Nobel-Etablissements mit Gesichtskontrolle („Ganymed“ und „Möve“), reiste 1986 als Gastprofessor an die Universität Greifswald, genoss die Gastfreundschaft von Steffi Eisler in Pankow oder redete noch im Sommer 1989 unter sorgfältiger Beobachtung so lange auf den Herrn Minister für Kultur der DDR, Hans-Joachim Hoffmann, ein, bis er sich geneigt zeigte, die Peter-Schroth-Truppe aus der Ernst-Busch-Schule mit Brechts Sezuan-Stück zum ersten "Donau Festival Ost-West" nach Ulm ausreisen zu lassen. Auch die DDR, obwohl sie keinen Kontakt zur Donau hatte, sollte, so kamen wir überein, als „deutscher Kulturträger“ bei einem solch wichtigen Ereignis nicht fehlen. – Noch gehöre ich dazu; aktuell führt mich der Suhrkamp Verlag mit 56 Titeln im Programm.
Der Autor (JK), ausgestattet mit der sicheren Überzeugung, seinen Artikel auf der Titelseite der „Literarischen Welt“ zu finden, begab sich an jenem Samstag, dem 27. Juni 2020, mit Gabriele Knopf auf einen längeren Spaziergang, um – da die Welt in seiner Stadt nicht übermäßig verbreitet ist – im Hauptbahnhof der südlichen Provinz seinen Artikel zu erwerben und sich an seiner Wiederlektüre zu ergötzen. Zugleich wollte er sich vorstellen, mit welch langem Gesicht der aktuelle Verleger Jonathan Langrebe sich seinerseits an der Lektüre von Verlagsgeschichten erfreute, die ihm offenbar nicht bekannt sind
oder nicht bekannt sein wollten.
Der Artikel stand nicht in der „Literarischen Welt“ vom 27. Juni 2020. Er stand auch nicht am 1. Juli 2020 im Feuilleton oder – das wäre noch so gerade als (leicht nachgereichter) Geburtstagsgruß terminlich zu rechtfertigen gewesen – in der folgenden Samstag-Ausgabe am 4. Juli 2020 der „Literarischen Welt“. Vielmehr reichte ihn die Welt nach mehrfachen Einsprüchen des Verfassers mit streng gekürztem, vor allem um alle Verlagsangelegenheiten kastriertem Text am Donnerstag, dem 23. Juli 2020, unauffällig nach, als alle schon den Geburtstag der Suhrkamp-Kultur vergessen hatten. Der Titel lautete jetzt „Männerfreundschaft aus dem Morgenrot des Internets“ und zeigte, dass die Herausgeber der „Welt“ die Pointe meines Textes offenbar nicht verstanden hatten, wie sie mir gleichzeitig einen Begriff unterschoben, der in meinem Wortschatz nicht vorkommt: „Männerfreundschaft“. Der riecht streng nach Kumpanei und Männerbündelei, und da verfärbte sich, wenn sie denn noch außer bei VW (da abvergast) vorkäme, die Rosenfingrige, wie die Eos, die Morgenröte, bei Homer noch hieß, ins Rostbraune.
Die Frage, ob bei einem solchen Verfahren – „freie“ Autoren haben keine Rechte, die sie erfolgreich einklagen könnten, und die Zeitungen behalten sich ausdrücklich „Kürzungen“ vor – der Verdacht auf Zensur naheliegen könnte, reiche ich an die geneigte Leserschaft dieses Blogs weiter.
P.S.: Mein Artikel enthält den Satz: „Fehlt noch der „politische Suhrkamp“, nicht der als Jude Verfolgte, sondern als der Helfer in der Not.“ Einen Einschub, der mir bei den heutigen Diskussionen um unsere – „bewältigte“ – Vergangenheit wichtig war: „(er war Deutscher und wurde als unbequemer Deutscher verfolgt)“, sodass der Satz vollständig lautete (s.o.): „Fehlt noch der „politische Suhrkamp“, nicht der als Jude Verfolgte (er war Deutscher und wurde als unbequemer Deutscher verfolgt), sondern als der Helfer in der Not.“ Im Zusammenhang meiner Ausführungen ist diese Streichung mehr als eine Nuance.
Der offizielle Welt-Artikel findet sich im Internet unter:
https://www.welt.de/kultur/plus211766913/Maennerfreunde-Wie-Brecht-und-Suhrkamp-das-Internet-erfanden.html
Um ihn ganz zu lesen, müssen Sie allerdings „Welt+“ kaufen; und denken Sie bitte nicht weiter über die Bildunterschrift (ohne Welt+ lesbar) „Die Botschaft ist das Medium“ nach; ihr Schwachsinn könnte Folgen für Sie haben, auch dann, wenn Sie Ihren Arzt oder Apotheker fragen.