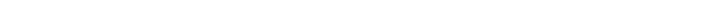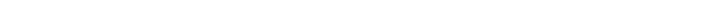Hilda Hoffmann, Berlin, verwaltet in der Rechtsnachfolge des verstorbenen Johannes Hoffmann das Erbe von Ruth Berlau (Angabe nach „Dreigroschenheft“ 4/2011, S. 24). Sie schrieb nach dem Tod von Werner Hecht am 26. Februar 2017 postwendend an ihn höchstselbst den folgenden Brief. Da Hilda Hoffmann ausdrücklich wünscht, dass eine >neue, kritisch unbeeinflusste Generation< die Sachverhalte neu beurteilen sollte und dies ja nur funktionieren kann, wenn ihre Einsprüche bekannt werden, publiziere ich ihren Brief. Das Einverständnis des Empfängers habe ich eingeholt, die Forderung der Verfasserin, die Fälschungen publik zu machen, hat sie in ihrem Schreiben ausdrücklich formuliert, sodass ich hiermit nur ihren ausdrücklichen Willen vollziehe. Also rufe ich im Sinn von Hilda Hoffmann zur Kritik auf.




Das gibt mir Gelegenheit, eine Widmung des Verfassers des Buchs und seiner Frau Gudrun Bunge, die an der Entstehung des Bandes mitgewirkt hat, zu reproduzieren. Sie galt dem „Gutachter“ Benno Slupianek (Berlin/DDR) und besagt, dass Hans Bunge mit seinem Produkt nicht zufrieden war. Gabriele Knopf sowie Wolfgang Jeske und Günter Berg, damals (1986) Lektoren im Suhrkamp Verlag, und ich waren Zeugen, als uns Hans Bunge vorführte, welche Diskrepanz zwischen Berlaus schriftlichen Zeugnissen und seiner Darstellung im Buch bestand – und was Ruth Berlau alles erfunden hatte, um ihre Position ins ihr rechte Licht zu rücken.
„Brechts Lai-Tu“ erschien 1985 im Hermann Luchtermann Verlag, Darmstadt, und nicht im Brecht-Verlag Suhrkamp, da alles, was Brecht betraf, von seinen Erben, vertreten durch Barbara Brecht-Schall, strenger Observation unterzogen wurde. Hans Bunge musste Zensur befürchten und entschied sich, das Gewebe aus Wahrheit und vorsätzlicher „Dichtung“ elegant zu überspielen und das zum Teil unverständliche Dänisch-Deutsch – Ruth Berlau war Dänin – ins Hochdeutsche zu transformieren. Diese Sachverhalte hat Bunge zwar in seinem Nachwort offengelegt, aber, wie dem so ist, das hat offenbar niemand so recht gelesen.
So kam es auch, dass die Brecht-Erben nicht zur Kenntnis nahmen, worin Hans Bunge die eigentliche Bedeutung Ruth Berlaus für Brecht und sein Werk sah. Als Mitarbeiterin an Brechts Texten kam sie schon wegen ihrer - für eine poetische Ausdrucksformen unzureichenden – Deutschkenntnisse nicht in Frage. Im Gegenteil „übersetzte“ Brecht ihre Erzählungen, die unter dem Titel „Jedes Tier kann es“ (1989) postum erschienen, in haltbares Deutsch. – Am 16.08.2012 schrieb Brecht-Schall an mich, um meine Behauptung, Ruth Berlau hätte das Brecht-Archiv gegründet, als „absolut nicht wahr!“ zu brandmarken: „Wie sollte Berlau das auch hätte machen können […, da] sie ständig betrunken war“. Hans Bunge hatte jedoch schon 1985 in seinem Nachwort (S. 305) formuliert: „Als Begründerin des Brecht-Archivs und als Dokumentaristin seiner Theaterarbeit nahm sie [Ruth Berlau] eine singuläre Stellung unter Brechts Mitarbeiterinnen ein.“ Ruth Berlaus außerordentlicher Einsatz, Brechts Manu- und Typoskripte im USA-Exil zwischen 1944 und 1947 zu fotografieren, zu sichern und damit das Fundament des Archivs zu legen, ist – im Gegensatz zu ihren vagen Erinnerungen – durch zahlreiche Dokumente faktisch nachweisbar und
gar nicht hoch genug einzuschätzen.