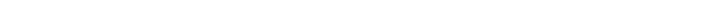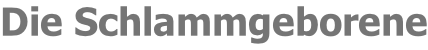
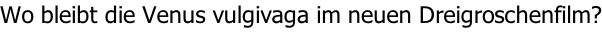
Am 30. Mai 2020 wird wieder der Weltuntergang sein. Da sich die Verkündigungen des nahen Endes überschlagen, die „Parallelen“ sich geradezu aufdrängen, rauschen wir doch in die neuen Zwanziger, in die „Golden Twenties“ –, muss noch eine kleine Erinnerung her, ehe wir auch dieses Jahr den Ausbruch des Volkans, auf dem wir tanzen, um ein weiteres verschieben. geben Unsummen aus, um ihnen das rechte Flair und die echten Kostüme zu verpassen, räumen, um ihre Atmosphäre »einzufangen«, den Berliner Alexanderplatz frei und holen uns aus dem Fundus die Modelle der elektrischen Eisenbahn, mit der wir schon lange nicht mehr so richtig gespielt haben, weil jetzt Far Cry in ist. Ist alles im Kasten, loben wir uns und verleihen uns erste Preise für beste Ausstattungen aus Steuergeldern. Nur eines verlangen wir nicht, dass sich die Darsteller, vor allem die Darstellerinnen – da beißen sich die finsteren Muster der Political Incorrectness fest – dem Authentischen fügen.-
Bildern zu inszenieren.
Die Charlotte Ritter, gespielt von Liv Lisa Fries, in Babylon Berlin muss sich zwar von ihrem Bruder frühmorgens bei der gewiss nötigen Morgentoilette – was für Serien dieser Art geradezu als kühne Sensation zu verbuchen ist – ein wenig anpissen lassen (Begründung: Morgenlatte, die der Knabe nicht im Griff hat), ansonsten hinterlässt ihre nächtliche Tätigkeit als adrette Domina in den Katakomben des MOKA EFTI keine Spuren. Nach diesem und jenem Wasserlass eilt die flotte Lotte frisch und munter ins rote Rathaus, um sich dort als Aushilfe bei der Sitte vorzudrängeln. Die Berliner Untergrundarbeiterin bleibt so smart wie das gleich lautende heutige Damen-
es passt wie das Wort überall hin.
Ab September 2018 soll diese Lotte, auch Charlie genannt, um eine Polly Peachum bereichert werden. Wir erinnern uns dunkel: das ist die hübsche Tochter des Bettlerkönigs Peachum aus dem Singespiel des John Gay, London 1728, die mit den hübschen Beinen und mit der netten Haut. Die kennten wir jedoch gar nicht mehr, hätte sie sich nicht ein Plagiator 200 Jahre später vor die schmale Brust genommen und mit der Musik eines Kurt Weill modern aufgepoppt.
Nach 90 Jahren Dreigroschenoper war es an der Zeit, endlich die Verfilmung auf eben den Markt zu werfen, der den damaligen Erfolgsleuten der Bühne den Zugang zum neuen Massenmedium Film verweigerte. Das Treatment, genannt Die Beule, abschwellend in den Dunkelkammern eines gewaltigen Werks, harrte des Rück-
„Dazu tanzt das aktuelle Fernseh-
Was uns erwartet, lässt sich einem kurzen Trailer, der seit einigen Tagen im Netz steht, mühelos entnehmen und auf den gesamten Film hochrechnen. Trailer sind ja sozusagen die Visitenkarten und sollen den ganzen Film knapp illustrieren. Polly sieht reizend aus, ihr Hintern ist unsichtbar unterm langen Kleid verhüllt und ihre rosa Pausbäckchen leuchten pfirsichzart. Als Mac an ihrem Nacken vorsichtig zupackt, fährt sie zwar ein wenig zusammen, schaut dann aber so rührend zu ihrem künftigen Bräutigam auf und mit ihren unschuldigen Rehäuglein in die Augen des künftigen Publikums, dass uns allen mit ihr zusammen das Herz aufgeht. Die Darstellerin heißt beinahe passend Hannah Herzsprung und ist ein Star; an ihrer Schönheit kratzt kein Makel.
Im nächsten Shot des Trailers finden wir das frisch gefundene Paar eng umschlungen in einem Boot mitten auf der Themse wieder. Die beiden Liebenden lächeln sich freundlich-
Für die Ausgangsposition des Films sah Brecht vor: Mackie Messer beschließt, ihn sehend, den Hintern, der da aufreizend vor ihm her wackelt, zu heiraten, aber nicht unbedingt die Frau dazu. Damit setzte Brecht die Zeichen für die ganze Handlung des Films. Es geht ans Eingemachte, und das ist da unten, wo man gewöhnlich nichts sieht. Deshalb muss es endlich ausgeleuchtet werden: lux in tenebris (so heißt ein früher Einakter BBs über Prostitution von 1919). Erleichternd käme hinzu: einen solchen zweiten, hinternen Mond, gut in Szene gesetzt, vergäße das geneigte Publikum nie. Freilich, woher ihn nehmen? Von den Darstellerinnen, den sich die Filmproduzenten von
heute ausgesucht haben, bekämen sie ihn nimmer.
Dass der Pfirsich sich, wie Polly im Dreigroschenroman durchgängig heißt, als ein wenig wurmstichig erweisen könnte, davon hätte bereits eine genauere Lektüre der Dreigroschenoper eine Ahnung geben können. Nicht umsonst hört Pollys Vater schon seit John Gay auf den Namen Peachum, neben »Pfirsich« altenglisch auch: der Verräter, der Hintergeher, der Menschenhändler, der sich seine Bettler zurecht schminkt, ehe er sie als der »ärmste Mann Londons« brutal ausbeutet, in der Sprache Brechts: »peinigt, auszieht, anfällt, abwürgt und frißt«.
„Das wirkliche Elend darf kein Gesicht bekommen..“
Der Polly-
Nicht anders sieht es mit dem eigentlichen »Helden« der Oper aus. Helden erfreuen sich inzwischen wieder hohen Ansehens und bestehen doch nur aus Leuchtpunkten, genannt Pixels, die im digitalen Glitter auf engstem Raum zusammengestaucht sind. Polly, von der versoffenen Mama gefragt, ob denn ihre neueste Eroberung auch »schön« sei, antwortet kleinbürgerlich angepasst, das nicht, aber er habe »sein Auskommen«. Im Dreigroschenroman (1933/34) wird – wie Polly zur Naschfrucht des Pfirsichs – der legendäre Mackie Messer endgültig zum Rettichkopf mit Eiterpickeln im Gesicht, gedrungener Figur, fettigem Teint und feistem Bauch. Brecht ahnte bereits bei der Besetzung der Uraufführung der Oper Böses und versuchte alles, den eitlen Operetten-
dass er wenigstens lächerlich wirken könnte.
Der Trailer des Dreigroschenfilms deutet an, dass der zu erwartende Film dies im Fall des Mackie Messer wie auch seines zweiten Helden – des BB nämlich in person –, tunlichst vermeidet. Lars Eidinger, der meinen mag, den Brecht »in sich« gefunden zu haben, gibt sich so leutselig wie ein heutiger Politik-
Brecht, der vor allem in Künstlerkreisen verkehrte (Rudolf Schlichter; George Grosz, John Heartfield, Caspar Neher), verarbeitete mit dem Bild des Pfirsichs als dem entzückenden Hintern das zeitgenössisch aktuelle Stillleben des Man Ray. Er fand es im Restaurant von Max Schlichter, dem Bruder des Malers, in seinen »hinternen Räumen« vor (so die Schreibung auf der von Brecht mitunterschriebenen Einladung zum Schlichter-
Und um die ging es dann vor allem.
Gegen diese Vermarktung der angeblich vom Muff der Kaiserzeit befreiten Frau schlugen Brecht und Weill – und das mit ungeahntem Erfolg – zurück. Sie kreierten die neue Frau, die Venus vulgivaga, die aus dem Schlamm der Gesellschaft geborene, griechisch Pandemos, berlinisch Nutte genannt, und zwar in zweierlei Gestalt: in der gutbürgerlichen Tochter des Geschäftsmann Peachum und in der geschäftstüchtigen Facharbeiterin Jenny. Beide sind denen, die sie bedienen, gefährlich. Nicht umsonst schlüpft Polly in die Rolle der Seeräuberjenny – an eurem Busen nährt ihr die Schlange –, und nicht umsonst übernimmt die Nutte den Part des zeitgemäßen Judas – dreimal wird sie ihn, den miesen Helden der Geschichte, verraten und an den Galgen bringen.
Dass das System noch nicht reif war für den Fall und der jedes Jahr neu beschworene Weltuntergang immer wieder verschoben wurde – für ein paar Jahre (heute: Vogelschiss genannt) –, kann nur der deus ex machina lösen, hier in der Gestalt des Boten der Königin, der das System noch einmal mit faulem Zauber rettet, heute die berühmte Null, die digital mit der 1 hochgerechnet wird, jedes Ergebnis ihrer quasi unendlichen Algorithmen-
Den Begriff der »Vulgivaga« (bitte nicht an »Vulva« denken, meint: die Umherschweifende) brachte der (sehr) bürgerliche Musikkritiker Hans Heinz Stuckenschmidt ins zeitgenössische Gespräch. Er verkündete die neue Aphrodite im Juni-
Seit 1922 spätestens betritt die – in der umfangreichen Brecht-
Valeska Gert war klein, pummelig, hatte dicke Schenkel, einen ausladenden Hintern und kleinen Busen, den sie als weiße Rundung markierte, damit er nicht ganz verloren ging. Sie trug ein körperlanges schwarzes Trikot, schminkte ihr Gesicht kalkweiß, die Lippen dick knallrot und umrandete die Augen mit dunklen Schatten so, dass diese wie in schwarzen Löchern lauerten, um dann regelrecht auf das Publikum einzustechen. Tanzte sie, dann öffneten sich ihre Lippen, spreizte sie ihre gewaltigen Schenkel und begann die Hüften aufreizend zu kreisen. Das Becken zuckte in fordernden Stößen. Lustgestöhn drang aus ihrem dunklen Schlund. Ihr Tanz sprang den Leuten buchstäblich in die Visage. Laute Empörung, einige Ohnmachten, Rufe nach der Polizei.
„..eine peinlich-
nicht zu ertragen war..“
Ansatzweise wäre zu bemerken gewesen, dass hier die Kunst in der Gestalt einer höchst lebendigen »Mumienkeilerin« (Kurt Tucholsky) dem Publikum auf, wenn nicht in den Leib rückte. Der Sinn ihrer Nummern war, die – schon kaum mehr wahrgenommene – Gewalt der neuen Maschinen, die die Revuen und Operetten der Zeit in funktionstüchtigen, rhythmisch gleichgeschalteten Menschenteilen auf die Bühnen brachten, in der lebendigen Herausforderung des geschundenen Körpers vor Augen zu stellen, eine peinlich-
Brecht nannte die neue Art des menschlichen Erlebens, handfest und körperschwach in den Materialschlachten des 1. Weltkriegs erfahren, das »Apparaterlebnis«. Die Nutte in der Gestalt der Canaille zeigte den geilen Herren der neuen, scheinbar freien und demokratischen Gesellschaft auf dem Weg in den Faschismus, was eine weibliche Harke sein könnte, setzte sich sie gesellschaftlich durch. Im Theater am Schiffbauerdamm betrat sie am 31. August 1928 wenigstens die Bühne des Theaters als die Gegenfigur zu Alles nackt!, zur gleichzeitigen Erfolgs-
Nur, was Brecht und Weill beim Erfolg der Oper nicht einplanten: Die Unterhaltungsindustrie war bereits in der Weimarer Republik bei allem Widerstand der Vertreter der so genannten hohen oder ernsten Kunst so weit fortgeschritten, dass sie auch diese provokative Kröte ohne weiteres schluckte, mit ihrer Vermarktung nämlich. Brecht war es, der zwar seinen Stoff (den er geklaut hatte) verkaufen, jedoch dessen kritische Potenz retten wollte und deshalb auch juristisch gegen die Filmindustrie antrat. Er benutzte dazu ausgerechnet das Mittel, der die zeitgenössische Justiz – die Gesetze hinkten den Realitäten hinterher – nicht gewachsen war, das Urheberrecht, das dem Einzelnen, dem schöpferischen Individuum, das ausschließliche (und vererbbare) Recht über seine Verwertung sicherte. Das Problem ist bis heute trotz Massengesellschaft und Volkskunst (jeder Mensch ein Künstler) nicht gelöst, wäre aber auch ein neues Thema. Die aktuelle Verfilmung, die den Dreigroschen-
Den traurigen Schlusspunkt im Trailer setzt Lars Eidinger alias »Bertholt Brecht«. Noch nicht einmal den Namen schreiben die Verantwortlichen des SWR in ihrer offiziellen Präsentation der beachtlichen Liste der Mitwirkenden korrekt. Eidinger alias BB himself kommentiert in einer für Brechts Theater typischen Publikumsansprache – Achtung: Ihr versteht es eh nicht – selbstironisch: »Wer die Handlung nicht gleich begreift, braucht sich nicht den Kopf zu zerbrechen, sie ist unverständlich. Wenn Sie etwas sehen wollen, was einen Sinn macht, müssen Sie auf das Pissoir gehen.«
Mal abgesehen davon, dass der Film offenbar für Damen nicht geeignet ist – wie wär‘s mit dem Hinweis der Freiwilligen Selbstkontrolle (FSK): »Keine Damenfreigabe« –, täuscht der sprachliche Fehlgriff, wie gehabt, über mangelnde Sachkompetenz hinweg und lenkt mit einem billigen Gag zudem von den Missständen ab, die er doch angeblich zeigen will. Dieses – heute sicher akzeptable – Englisch-
Bei Brecht steht: »Wenn sie nur etwas sehen wollen« – die Ausschließlichkeit macht die Sache verbindlich und zielt auf die traditionell verkopften Hirne der (deutschen) Literatur-
Der Spruch stammt übrigens aus Brechts Erfolgs-

Tänzerin Valeska Gert: „Laute Empörung, einige Ohnmachten, Rufe nach der Polizei.“