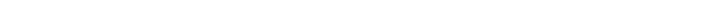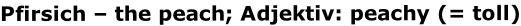
Englisch „Peach“ heißt „Pfirsich“. Diese saftige Frucht kam im 1. Jahrhundert nach Christus aus China über die Parther zu den Römern als „persischer Apfel“, lateinisch: »Prunus Persica«. Er strahlt sympathisch gelblich-
Das pralle Leben ist nicht durch Abbilder zu ersetzen. Deshalb darf das fruchtbare Schmuckstück, um ihm Bedeutung zu verliehen, nicht naturalistisch, nicht fotografisch wiedergegeben werden. Die Farben werden pink geoutet, die Formen herzförmig gestreckt, die Rundungen ein wenig fleischig erweitert, die Kerbe zierlich vertieft, damit diese dann leicht verschwommen ins Vage abtauchen und die Fantasie aufreizen kann.
Wer dann an alles Mögliche denkt: von spritzenden Säften über knackig-
„Fremd“ hieß im Griechischen „barbarisch“. Davon abgeleitet ist der weibliche Vorname „Barbara“. Damit erklärt sich, warum Pollys Lieblingslied (was die Männerwahl anbetrifft) ausgerechnet der „Barbarasong“ ist und die frisch Angetraute ihrem Gangstergatten Mackie Messer als Hochzeitslied die „Seeräuberjenny“ unterjubelt. Dabei ist zu beachten, dass diese Jenny nicht mit der Hure gleichen Namens identisch ist. Das Lied wurde in den Verfilmungen der Oper ins Bordell verlegt und dort von der Hure Jenny gesungen. Dadurch entstand der Anschein: sie wäre die Seeräuberjenny.