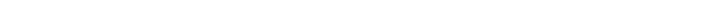2017/18: Brecht als Alibi-
Folgt jetzt die Fortsetzung?
Das Theater am Schiffbauerdamm aktuell (2018): bei Nacht im Film / bei Tag original




Statt des BE-
Die Episode (Staffel 2/6) von „Babylon Berlin“ spielt am 30. Mai 1929. / Auf dem Programm steht „Die Dreigroschenoper“
von Brecht-
Emblem des BE (Leuchtschrift)
Die Macher von „Babylon Berlin“, die beanspruchen, historisch authentisch zu sein, geben das Gebäude im heutigen Zustand wieder



Das „Theater am Schiffbauerdamm“ sah aber bis 1953 so aus – und ab 1954 so (bis heute):
Mit wenig Aufwand wäre zu eruieren gewesen, dass sich im Jahr 1929 der Turm in voller neofeudaler Pracht, mit allen Türmchen, mit allem Schmuck, mit allen Ornat, mit allem neobarocken Zierrat sowie mit der wunderbaren und hohen Turmhaube aus dem Häusermeer erhob, einer Haube, auf der keine Fahne sinnvoll zu platzieren gewesen wäre.
Heinrich Seeling, der Architekt des Hauses, 1892 als „Neues Theater“ errichtet, hielt einen solchen Turm deshalb für nötig, damit sein Bau im dichtbesiedelten Zentrum von Berlin wenigstens mit diesem reichverzierten Prachtexemplar ein wenig aus dem Häuserdickicht herausragte: feierlich, hoch, trotzig, wuchtig, nicht als Symbol für Nationales, sondern als verspieltes Zeichen für Theater, schön, aber nicht jederfraus Geschmack, teuer, sichtbar, zwecklos und fröhlich.
In dieser Gestalt überstand das Theater den 2. Weltkrieg und den „Vereinigungs-
In dieser Form präsentiert die Kult-

„Hören Sie nun einen Kommentar zum Besuch des französischen Außenministers Aristide Briand bei seinem deutschen Amtskollegen Gustav Stresemann. Die deutsch-
Der Text, im Wortlaut nur schwer hörbar, ist wie Hintergrundsmusik der Handlung unterlegt, und dient dazu, den aktuellen Tag als mögliches Datum eines Attentats (Stichwort: Prangertag) zu identifizieren. Die Szene schwenkt über zur Trutzburg deutscher Nationalkultur:
Auslöser für die Szene innerhalb der Episode 6 der Serie, die ansonsten in keinem Zusammenhang mit der Gesamthandlung steht, ist der „Mackie-


Neue Preußische Kreuz-
Das Ganze ließe sich am besten als eine literarische Leichenschändung bezeichnen, an der das einzig Bemerkenswerte wäre, die Nichtigkeit des Objektes, an welcher sie vollzogen wurde, und die, schon kaum noch mit dem gelinden Worte Naivität zu umschreibende Ahnungslosigkeit […], mit solchem absoluten Nichts ein Theaterprogramm auffüllen zu können.
*
Neue Zeitschrift für Musik, Regensburg, Heft 2, 1929, S. 99f.:
Die Dreigroschenoper der Herren Brecht und Weill / […] legt drastisch davon Zeugnis ab, wie tief wir vor allem geistig gesunken sind […], der klafterweite geistige Abstand von Original und Neufassung [erweckt] aufrichtiges Mitleid mit dem Verfasser […]. Brechts geistige Unfähigkeit äußert sich darin, daß er […] Altes und Neues vollkommen durcheinanderwirft, weder das Original verstanden hat, noch unsere Zeit irgendwie klar sieht. Da kommt denn weiter nichts als ein ganz plumpes Amüsierstück zustande, das sein Originellstes, das Spiel in der Welt von Dieben und Dirnen, dem englischen Stück verdankt.
*
Peter Panter [d.i. Kurt Tucholsky], 1930:
Das knallt, das stinkt, das knufft und das schießt; das jagt auf Mustangs durch die Wüste, das säuft und spielt, das flucht und hurt... aber so schön weit weg, in Indianien, wo es gar nicht gibt [...] Diese Dreigroschen-
*
Elias Canetti, deutscher Nobelpreisträger für Literatur 1981:
Die Leute jubelten sich zu, das waren sie selbst und sie gefielen sich. Erst kam ihr Fressen, dann kam die Moral, besser hätte es keiner von ihnen sagen können, das nahmen sie wörtlich. Jetzt war es gesagt, keine Sau hätte sich wohler fühlen können. (Die Fackel im Ohr. Lebensgeschichte 1921–1931. 1980, S. 318).
*
Neuer Vorwärts, Berlin, Nr. 159, Wochenausgabe, 28. Juni 1936:
Hin und wieder gehen durch die Nazipresse lange Fetzen, in denen mit Zitaten die Verworfenheit der Lyrik und Moral vor 1933 bewiesen werden soll. (…) Um so mehr wird die Dreigroschenoper ausgeschlachtet; denn der nicht beschlagene Leser weiß ja nicht, daß Brecht mit seinen Gassensongs darin die Moral und Stickluft einer faulenden Gesellschaft treffen will.
****
30. Mai 1929, Schlagzeilen der Berliner Börsen-
und der Deutschen Allgemeinen Zeitung (Morgenausgabe, Nr. 244): „Deutschland bezahlt alles!“
„Berliner Funk-